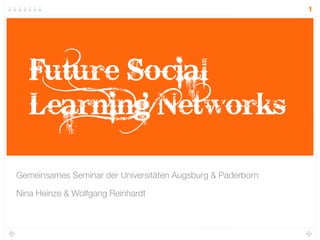
Fsln10 intro
- 1. 1 Future Social Learning Networks Gemeinsames Seminar der Universitäten Augsburg & Paderborn Nina Heinze & Wolfgang Reinhardt
- 5. 5 Ziele des Seminars nicht Lernen über etwas Neues, sondern Lernen mit etwas Neuem Blick über den Tellerrand interdisziplinäre und interkulturelle Kooperation Koordination und Kommunikation über Universitätsgrenzen hinweg aktive Auseinandersetzung mit den Themen des Seminars Entwicklung von Designs, Methoden, Prototypen Spaß an der Arbeit
- 7. 7 Kooperation + Themenvergabe Pro Thema mindestens 1 Student aus Paderborn + 1 Student aus Augsburg Kommunikation & Koordination über bereitgestellte Tools Betreuung jeweils von 1 Mitarbeiter aus Paderborn / Augsburg Jeder Teilnehmer kann 3 Wunsch-Themen äußern, Zuordnung über First- Come-First-Serve und Best-Match
- 8. 8 Sonstiges ständige Dokumentation des Arbeitsfortschritts in bereitgestellten Wikis Finale Abgabeversion: 20 Seiten inkl. Abbildungen, Literatur im LNI Stil regelmäßige Feedbacks Google Form zu Kooperation, Kommunikation, Format des Seminars
- 9. 9 Bewertung Bewertungskriterium Anteil Beteiligung im Seminar (Mixxt, Twitter, Delicious & Co. 30% eingeschlossen) kontinuierliche, kooperative Erstellung einer Seminararbeit 20% Kreativität, Engagement 20% Präsentation des Seminarthemas 15% Qualität und kreative Augestaltung des Artefakts 15%
- 10. 10 Termine 20.04. Erstes Treffen 27.04. Vergabe der Themen + Vortrag zu Social Media & Learning Erste Mai-Woche: Fokusbesprechung mit Betreuer Dritte Mai-Woche: Fokusbesprechung mit Betreuer Erste Juni-Woche: Fokusbesprechung mit Betreuer, Vorstellung Prototyp 01.07. Abgabe der pre-finalen Seminararbeit 16.07. + 23.07. + 30.07. Blockveranstaltungen für Vorträge 31.07. Abgabe der finalen Seminararbeit
- 11. 11 Eingesetze Tools Delicious Skype Social Bookmarking Audio-/Video-Konferenzen http://delicious.com http://skype.com Twitter FlashMeeting Microblogging Video-Konferenzen http://twitter.com http://fm Mixxt Doodle Social Networking Site Umfragen http://fsln.mixxt.com http://doodle.com
- 12. 12 Tagging fsln10 #fsln10
- 13. 13 Themen
- 14. 14 Themenübersicht 1. Engagement Analysis 8. Real Time Cooperative Learning 2. Smart Devices for u-Learning 9. Awareness in Learning Networks 3. Artefact-Actor-Networks 10.Computer Science Unplugged 4. Die FSLN PLE 11.Medienbrüche im Web 2.0 5. University 2.0 12.Interaktive Lernressourcen 6. Game-based Learning 13.Language Technologies for Learning 7. Semantic Web. Und nun?
- 15. 15 Engagement Analysis Motivation viele elektronische Hilfsmittel im formellen & informellen Lernen wie aktiv / engagiert sind die Lernenden? Annahme: durch mehr Engagement wird besser gelernt Messen? Möglichkeit der Anwendung bekannter Metriken für Webseiten-Analyse Entwicklung neuer Community-Metriken und spezieller Engagement-Ansätze
- 16. 16 Engagement Analysis Fragen Was ist EA und wie ist sie theoretisch begründet? Welche Metriken für EA gibt es und wie lassen sie sich anwenden? Abgrenzung zu anderen Ansätzen (z.B. Social Media Monitoring) welche Teile sind empirisch fundiert, was muss “geraten” werden? Zielstellung Anwendung der theoretisch erworbenen Kenntnisse auf das FSLN Seminar Entwicklung eines Prototypen zur EA für die eingesetzten Technologien
- 17. 17 Engagement Analysis Literatur http://www.onlinecommunityreport.com/2009/09/online-communities- metrics-and-reporting-2009/ http://www.slideshare.net/13stock/metriken-und-messbarkeit-im-social-web Dorit Maor: Engagement in Professional Online Learning, http:// www.editlib.org/p/6203 http://beerc.wordpress.com/2009/10/22/what-is-learner-engagement/
- 18. 18 Smart Devices for Learning Motivation Multimedia brachte die Außenwelt zu den Lernern Smart technologies werden die Lerner zur Außenwelt bringen Augmented Reality wird zur Realität, Kosten sinken Fast jeder Student mit Mobiltelefon und Internetzugang ausgestattet viele besitzen Smartphones oder smart devices
- 19. 19 Smart Devices for Learning Fragen Wie können Smart devices im persönlichen | organisatorischen Lernen eingesetzt werden? Welche Herausforderungen gibt es dabei? Was sind realistische Anforderungen an Lehrende, Lerner und Devices? Zielstellung Entwicklung eines (informatischen) Lernszenarios, in dem Smart Devices essentieller Bestandteil sind Entwicklung eines Prototypen unter Verwendung von Smartphones
- 20. 20 Smart Devices for u-Learning Literatur Rachel Cobcroft: Literature Review into Mobile Learning in the University Context, http://eprints.qut.edu.au/4805/ Steve Wheeler: New Smart devices for learning, http://www.slideshare.net/ timbuckteeth/new-smart-devices-for-learning http://www.wired.com/epicenter/2009/02/ted-digital-six/ Microsoft SenseCam: http://research.microsoft.com/en-us/um/cambridge/ projects/sensecam/ Ubiquitous Learning Conference | Journal
- 21. 21 Artefact-Actor-Networks-Analyse Motivation Soziale Netzwerkanalyse betrachtet nur soziale Verbindungen in Netzwerken Artefaktbeziehungen werden kaum analysiert Bekannte Analysemetriken von SN müssten sich auf AAN übertragen lassen Validität der Metriken überprüfen Besondere Eignung einiger Metriken herausstellen
- 22. 22 Artefact-Actor-Networks -Analyse Fragen Lassen sich Metriken der SNA auf AANs übertragen? Welche Aussagen können dann über Artefakte getroffen werden? Wie lassen sich AANs gut darstellen? Zielstellung Prototypische Anwendung verschiedener Metriken auf das AAN des Seminars, Visualisierung mit einer bestehenden Software
- 23. 23 Artefact-Actor-Networks-Analyse Literatur Wolfgang Reinhardt et al.: Artefact-Actor-Networks as tie between social networks and artefact networks http://gephi.org/ Social Network Analysis, http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network Granovetter: The strength of weak ties
- 24. 24 Die FSLN PLE Motivation Lernen und Bildung werden immer individueller Personal Learning Environments als Ansatz, um dem Lerner eine individuelle, anpassbare Lernumgebung an die Hand zu geben Mainstream-Diskussion ohne wirkliches bildungrelevantes Ergebnis P = Personal oder P = Personalized LE = Online? Offline? Digital?
- 25. 25 Die FSLN PLE Fragen Was macht eine PLE sozial und zukunftstauglich ? Welche Funktionen und Interaktionstypen müssen vorhanden sein? Zielstellung Konzeption und Entwicklung einer FSLN PLE aufbauend auf offenen Standards, Betrachtung von Web, Desktop und mobilen Geräten Widget-basiert? Kontext-basiert?
- 26. 26 Die FSLN PLE Literatur Graham Attwell: Personal Learning Environments - the future of eLearning? Mark van Harmelen: Personal Learning Environments http://www.pontydysgu.org/category/ples/ Paper der MUPPLE Workshops
- 27. 27 University 2.0 Motivation Technologische und soziale Umbrüche finden statt Consumer vs. Prosumer Bachelor/Master - Diskussion Qualitätsansprüche der Studierenden neue (soziale) Interaktionsformen
- 28. 28 University 2.0 Fragen Wie sollte die Universität der Zukunft aussehen (technologisch, didaktisch, partizipativ)? Was muss (realistisch) verändert werden, um Universitäten zukünftig noch besser zu machen? Zielstellung Durchführung einer Umfrage unter Studenten, Lehrenden, techn. Mitarbeitern Abgleich mit Zukunftsprognosen
- 29. 29 University 2.0 Literatur Horizon Reports 2008, 2009, 2010 John Unsworth: University 2.0, http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ PUB7202w.pdf Hashimshony et al.: Designing the University of the Future, http:// www.educause.edu/Resources/DesigningtheUniversityoftheFut/154292 Julie Hurd: Transformation of Scientific Communication: A model for 2020, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download? doi=10.1.1.84.8288&rep=rep1&type=pdf
- 30. 30 Game-based Learning Motivation Spiele als Ort für informelles Lernen große, sehr aktive Communities bisher kaum aktiver Einsatz in Lehrveranstaltungen
- 31. 31 Game-based Learning Fragen Wie und Was lässt sich „spielend lernen“? Wo liegen die Anreize in Spiele-basierten Lernansätzen? Wie kann eine Bewertung stattfinden? Zielstellung Entwicklung eines Spiele-basierten Lernkonzepts für ein Kernthema des Informatikstudiums (Bachelorstudium) Prototypische Umsetzung des Spieleansatzes
- 32. 32 Game-based Learning Literatur http://www.e-teaching.org/didaktik/konzeption/methoden/lernspiele/ game_based_learning/ Marc Prensky: Digital Game-Based Learning http://www.educational-gaming.de/ Kaido Kikkas: Playful Cleverness revisited: open-source game development as a method for teaching software engineering
- 33. 33 Semantic Web. Und nun? Motivation Erweiterung des WWW Ziel des Semantic Web ist es Informationen Maschinenlesbar und - interpretierbar zu machen Vorschlag von Tim Berners-Lee 1999, heute bereits breite Anwendung Probleme: Standards, Interoperabilität, Begriffe, Anwendungenen
- 34. 34 Semantic Web. Und nun? Fragen Wie lässt sich Semantic Web sinngebend in die Lehrpraxis einbinden? Welche Rolle spielt Semantic Web im formellen / informellen Lernen? Wie kann eine Lern- und Arbeitsplattform aussehen, die auf semantischen Technologien basiert? Zielstellung Entwicklung einer semantischen Lern- und Arbeitsplattform für den Einsatz an Eurer Universität.
- 35. 35 Semantic Web. Und nun? Literatur Tim Berners-Lee: The Semantic Web Revisited John Breslin et al.: The Social Semantic Web Pellegrini, Blumauer: Social Semantic Web. Web 2.0 - Was nun? http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/projects/semantictechnologies.aspx
- 36. 36 Real Time Cooperative Learning Motivation Twitter, Google Wave, Google Buzz u.a. ermöglichen die Echtzeit- Kommunikation und Kooperation Konzepte wie Shared Whiteboards noch nicht in der Lehre angekommen Etherpad, Google Docs, Adobe Buzzword schaffen Echtzeit-Schreibkanäle Integration von Echtzeit-Tools in kooperative Lehr-, Lernprozesse erwünscht!?
- 37. 37 Real Time Cooperative Learning Fragen Wie lassen sich RTC-Tools sinnvoll in die universitäre Lehre einbinden Welche konkreten Anwendungsfälle gibt es? Wo liegen die Vorteile und Herausforderungen? Zielstellung Lerndesign für einen Universitätskurs unter Nutzung von RTC Techniken Entwicklung eines MashUp-Prototypen für die Blockseminare des Seminars Twitter, Audioboo, GoogleDocs, Etherpad .... Add your application here
- 38. 38 Real Time Cooperative Learning Literatur Chow Wun Han: Platforms for real-time collaborative learning for .... http://www.learninginrealtime.com/ http://typewith.me/ aka http://code.google.com/p/etherpad/ Twitter in Education Shared whiteboards in Education
- 39. 39 Awareness in Learning Networks Motivation verschiedene Tools, verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Nutzernamen Awareness in CSCW seit Jahrzehnten ein Thema Social Software und Social Media erzeugen unglaubliche Datenmengen kaum Struktur, “Informationsflut” Hilfe zur Wahrnehmung wichtiger Personen, Themen, Artefakte, Termine...
- 40. 40 Awareness in Learning Networks Fragen Welche Awareness gibt es? Wie kann man sie unterstützen? W-Fragen: Wer? Wann? Wo? Was? Wie? Womit? Warum? Lassen sich entstehende Personen- und Artefaktnetze sinnvoll nutzen? Zielstellung Entwicklung eines Prototypen zur Awareness-Unterstützung in Learning Networks, Anwendung auf FSLN-Seminar Artefakte, Relationen, Updates, Locations, Groups, Shared Context
- 41. 41 Awareness in Learning Networks Literatur Gutwin: The effects of workspace awareness support on the usability of real- time distributed groupware Gutwin et al.: Workspace Awareness in Real-Time Distributed Groupware: Framework, Widgets, and Evaluation Berlage: Visualizing Common Artefacts to Support Awareness in Computer- Mediated Cooperation Ignat et al.: Providing awareness in multi-synchronous collaboration without compromising privacy
- 42. 42 Computer Science Unplugged Motivation Vermittlung von Informatik Grundprinzipien OHNE Computer besseres Verständnis von Methoden, Datenstrukturen, Abläufen und Prinzipien Erfolge in Schulen und Kindergärten
- 43. 43 Computer Science Unplugged Fragen Wie können Informatik-Kernthemen ohne Einsatz von Technologie vermittelt werden? Vorstellung von bestehenden Ansätzen und Methoden Zielstellung Entwicklung eines CS-unplugged Lernkonzepts für ein Kernthema des Informatikstudiums (Bachelorstudium)
- 44. 44 Computer Science Unplugged Literatur http://www.csunplugged.org/ http://www.kompetenzz.de/Genderaktivitaeten/Informatik-unplugged Gallenbacher: Abenteuer Informatik Magenheim et al.: Informatik Macchiato
- 45. 45 Medienbrüche im Web 2.0 Motivation viele verschiedene Plattformen, Tools und Daten im Web 2.0 häufige Wechsel des informationstragenden Mediums um Aufgaben zu bewältigen Behinderung des Arbeitsprozesses, Verminderung der Ergebnisqualität, Verlust des Arbeitskontextes
- 46. 46 Medienbrüche im Web 2.0 Fragen Wie, wo und wodurch treten häufig Medienbrüche im Web 2.0 auf? Was sind Ansätze zur Minderung oder Vermeidung von Medienbrüchen im Web 2.0? Zielstellung Spezifische Betrachtung von Medienbrüchen im Web 2.0 / Social Web Entwurf (prototypische Umsetzung) eines Medienbruchfreien Studierenden- Arbeitsplatzes
- 47. 47 Medienbrüche im Web 2.0 Literatur Reinhard Keil: Medienqualitäten beim eLearning: Vom Transport zur Transformation von Wissen Reinhard Keil et al.: MObiDig - Manipulierbare Objekte in digitalen Systemen Harald Selke: Sekundäre Medienfunktionen für die Konzeption von Lernplattformen für die Präsenzlehre
- 48. 48 Interaktive Lernressourcen Motivation Traditionelle Lernressourcen (Bücher, PDFs, Webseiten) sind meist sehr statisch Wunsch nach dynmischen Teilen und Interaktionsmöglichkeiten für den Betrachter besseres Verständnis durch Visualisierungen Kontakt zum Autor Push neuer Informationen
- 49. 49 Interaktive Lernressourcen Fragen wie können traditionelle Lernmaterialien durch neue Technologien aufgewertet werden? Einsatz von Audio, Video, Geo-Werkzeugen, Animationen, Games, Web Services Zielstellung Entwicklung interaktiver Lernressourcen im thematischen Umfeld des Seminars (bspw. PDF Anbindungen an WolframAlpha oder YouTube oder Yahoo! Finance oder Wetter.com oder oder oder)
- 50. 50 Interaktive Lernressourcen Literatur http://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Interactive_learning_resources http://www.wsieservices.be/Interactive_Content.htm http://www.insideria.com/2009/01/running-flex-applications-adob.html http://www.adobe.com/devnet/
- 51. 51 Language Techn. for Learning Motivation viel studentische Arbeit ist Text-basiert Leistungsfähige Tools zur textuellen Analyse, Clusterung etc. vorhanden Text als Input, analysierter, annotierter, getagter Text als Output viele sinnvolle Einsatzszenarien zur Unterstützung von Studenten und Lehrenden
- 52. 52 Language Techn. for Learning Fragen Welche Tools, Methoden und Konzepte für LTfL existieren? Wie funktionieren sie? Wie können LTfL mit Mehrwert in den Hochschulalltag eingebunden werden? Wem helfen sie? Wie helfen sie beim Lernen? Zielstellung Entwicklung eines Prototypen zur Unterstützung einer typischen Studenten- aktion durch LTfL
- 53. 53 Language Techn. for Learning Literatur http://www.ltfll-project.org/ http://www.opencalais.com/ Latent Semantic Analysis (LSA), http://lsa.colorado.edu/papers/ dp1.LSAintro.pdf Ontologies, http://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_%28information_science %29
- 55. 55 Nächste Schritte Accounts erzeugen und sich gegenseitig folgen/befreunden Twitter, Delicious, Mixxt Doodle-Poll zu Wunschthemen (max 3) bis Ende der Woche ausfüllen http://www.doodle.com/q2ageqpbqcrnz43w Eingangsumfrage ausfüllen http://bit.ly/FSLN_Survey1 Nächste Woche: Einteilung der Gruppen Vortrag zu Social Media und Social Networking
- 56. 56 Auf geht’s. Viel Spaß! Nina Heinze Wolfgang Reinhardt @sywot @wollepb Universität Augsburg Universität Paderborn Raum 1121 F2.114 Let’s do it
