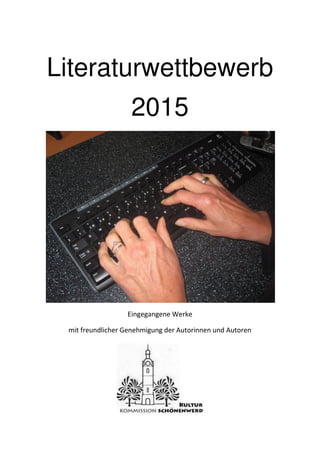
Literaturwettbewerb 2015 komplett
- 1. Literaturwettbewerb 2015 Eingegangene Werke mit freundlicher Genehmigung der Autorinnen und Autoren
- 2. Nr Name Vorname Titel a 1 Segessenmann Georg Schutzengel a 2 Schär Enrico Eine aussergewöhnliche Begegnung a 3 Mäder Roland Das göttliche Treffen a 4 Häubi Lisbeth Aussergewöhnliche Begegnung a 5 Anselmi Verena Mutz mit oder ohne a 7 Gerber Heinz keine Freigabe a 8 Vetter Franziska (*) Eine aussergewöhnliche Begegnung a 9 Füllemann Fiona Hummel und Spinat a 10 Fallegger Verena Susanne Meier Mazda a 11 Leuenberger Tanja Geschichte a 12 Siegenthaler Silvia Marina a 15 Burkard Anita Geisterzug a 16 Matter Nathalie 13 aussergewöhnliche Begegnungen a 19 Hunziker Claudia Mit einem Rollstuhl Junioren b 6 Trüssel Natascha Engel Love b 13 Marti Tina (*) Die Begegnung mit Schneebi b 14 Marti Jessica Schwarzer Schlaf b 17 Berger Silvana Eine aussergewöhnliche Begegnung b 18 Venditti Ephraim Eine aussergewöhnliche Begegnung * Kategoriensieger
- 3. 1 Schutzengel Begegnungen. Begegnungen? Na was denn? Na wem denn? Mir selber vielleicht? Keine schlechte Idee, meine ich. Denn es ist ab und zu ganz amüsant, sich selber zu begegnen, sich selber kennen zu lernen, sich selber kritisch unter die Lupe zu nehmen, sich so versuchen zu sehen, wie einen die Anderen wohl sehen werden, ironisch, hemmungslos, vorurteilslos, schonungslos sich selber begegnen. Aber wie geht das denn? Hat denn nicht Jeder das Bestreben, sich selber zu schonen, sich selber in einem Lichte zu sehen, das ihm eher einen Lichtkranz über dem Haupte kreiert, als eine Handvoll Asche über demselbigen? Anhand der nachfolgenden Geschichte versuche ich, den Lichtkranz mit der Asche zu vermengen, einen neuen, meinen, sozusagen aschfahlen Lichtkranz zu schaffen. **************************************** Der Durst drängt mich in eine Gartenbeiz am Rande meines Wanderweges. Ich setze mich in den Schatten eines mächtigen Kastanienbaumes, dessen Früchte bereits üppig gerundet durch das Blattgrün äugen. Die Serviererin stellt mir das soeben mit letzter Kraft bestellte kühle Bier auf den blechernen Dreibeintisch. Mit einem einzigen langen Zug leere ich das Glas zur Hälfte und lehne mich dann, wohllüstig rülpsend, nach hinten. Ich schliesse meine Augen und entspanne mich. Nach einer Weile öffne ich die Augen, unwillig und irritiert, weil ich das Gefühl habe, ich würde beobachtet. Da sitzt tatsächlich auf dem Stuhl gegenüber ein seltsames Wesen. Gewandet ist es in einen tüllartigen Schleier; das Gesicht ist merkwürdig bleich, als wäre es durchsichtig; auf dem Rücken gewahre ich, schemenhaft gleichsam, zwei Auswüchse: Flügel? Wir schauen uns lange in die Augen. Das heisst, eigentlich schaue ich durch die Augen meines Gegenübers hindurch in die Unendlichkeit. Langsam verzieht sich das ernste Gesicht zu einem angedeuteten Lächeln, welches ich wie
- 4. 2 unter Zwang erwidere. Das Geistwesen hat vor sich ebenfalls ein Glas Bier, welches es nun langsam hebt, mit einem leisen „Prost!“ an die Lippen setzt und in einem Zuge austrinkt. Dann streckt es das leere Glas in Richtung Wirtschaft. Und schon kommt die Serviererin mit einem vollen Glas und wechselt es gegen das leere aus. Kaum abgestellt verschwindet der Inhalt in der Kehle des Geistwesens. Ich staune, denn wieder wird das Glas innert Sekunden gegen ein volles ausgetauscht. Meinen vor Staunen leicht geöffnetem Lippen entfährt ein leises „Ohhhh Gott!“. Der Engel – kein Zweifel, um einen solchen handelt es sich bei meinem Gegenüber – lässt ein leises Mecker-Kichern hören. Dann wischt es den Rest des Schaumes ab, der auf seiner Oberlippe verharrt ist, und sagt: „Lass meinen Chef aus dem Spiel….“ „Entschuldige“, stottere ich. „Ich musste nur……“ „Na da staunst du, was?“, unterbricht mich das Wesen. Ich schlucke dreimal leer, dann wage ich eine Frage: „Bist du wirklich ein Engel?“ „Aber sicher!“, kommt es von drüben. „Aber nicht ein gewöhnlicher. Nein, ich bin ein Schutzengel!“ „Ja, aber warum sitzt du denn hier?“, wende ich verblüfft ein. „Ein Schutzengel sollte doch nicht saufen, entschuldige: trinken, sondern auf jemanden aufpassen?“ „Da hast du natürlich Recht“, erwiderte der Engel. „Aber ich bin so überfordert, dass ich einfach den Bettel hingeschmissen habe und mir nun zuerst einmal ein paar Bierchen genehmigen muss, damit ich den Stress des Aufpassens wieder verkraften kann! Meine Aufgabe ist es nämlich, auf ein kleines Kind aufzupassen – dort auf der Schaukel sitzt es übrigens. Kannst du dir vorstellen, was das heisst?: Vierundzwanzig Stunden am Tag und in der Nacht immer an der Seite oder hinter einem kleinen Kind, das über die Strasse rennt, am Weiher spielt, unter die Schaukel rennt wenn andere darauf schaukeln, aus Flaschen trinkt, die die Mutter mit Putzzeug gefüllt hat, auf den Fenstersims klettert und-und-und....! Aber das schlimmste daran ist erst noch, dass die Mutter, die doch selber weiss, was einem kleinen Kind passieren kann, in wahnwitzigem Tempo mit dem Kind ohne Kindersitz in ihrem Auto über die Strassen flitzt, an parkierten Autos entlang, wo doch jeden Augenblick ein Kind hervor rennen könnte. Ich sitze dann jeweils auf dem Hintersitz und kann manchmal nur noch die Hände vor die Augen schlagen vor Angst und Schrecken, weil uns das Reagieren auf solche Geschwindigkeiten einfach nicht einprogrammiert worden ist!“ Der Engel rollt seine Augen und greift nach dem siebten vollen Glas, das wie von Geisterhand wieder hingestellt worden war, während der Engel sich in Rage redete. Da wage ich es, eine Frage zu stellen, die mir schon die ganze Zeit unseres Gespräches auf der Zunge liegt: „Sag mal......., habe denn auch ich alter Mann noch einen Schutzengel?“ Mein Gegenüber schaut mir gedankenverloren in die Augen. Dann erwidert der Engel leise und dabei geheimnisvoll mit dem Zeigefinger über meine rechte Schulter deutend: „Natürlich; dreh dich doch mal um!“ Langsam drehe ich mich um und sehe am Tisch hinter mir eine ebenso weisse Gestalt sitzen, die in der einen Hand ein Glas Bier und in der anderen ein grosses Schnapsglas hält. Auf dem Tisch stehen eine ganze Reihe leerer Bier- und Schnapsgläser. Das Gesicht der Gestalt ist merkwürdig grau und runzlig. Erschrocken drehe ich mich wieder zu meinem Gegenüber und raune: „Was, das soll mein Schutzengel sein? Warum sieht der denn so frustriert in die Welt?“ Da höre ich in meinem Rücken meinen eigenen Schutzengel raunzen: „Ja glaubst du denn, es mache mir Spass, auf einen solch langweiligen Stubenhocker aufpassen zu
- 5. 3 müssen? Ooooh Gott, mein Gebieter, was habe ich denn verbrochen, dass du glaubst, mich so strafen zu müssen?!“ Ich spürte wie ich bleich wurde. Es konnte ja sein, dass dieses Geistwesen tatsächlich mein Schutzengel hätte sein können. Aber was berechtigte ihn dann, mich so ungnädig abzuqualifizieren? Was hatte ich dem Kerl denn angetan, dass er sich erfrechen durfte, über mich ein solch vernichtendes Urteil zu sprechen? Ich rief nach der Bedienung und verlangte die Rechnung. „Aber die Schnäpse und Biere des unflätigen Kerls dort hinten bezahle ich dann etwa nicht“, knurrte ich. Die Serviererin guckte zuerst in die von mir angezeigte Richtung, runzelte die Stirn und sah mich dann zweifelnd an. Ich konnte direkt in ihren Augen lesen, dass sie mich insgeheim für verrückt erklärte – weil sie offensichtlich das nicht sah, was ich sah. Schnell nahm sie das von mir hingezählte Geld und verschwand eiligst, nicht ohne mich nochmals mit einem mitleidig-entgeisterten Blick zu bestrafen. Ich erhob mich, ohne meinen angeblichen Schutzengel nochmals eines Blickes zu würdigen und machte mich auf meinen Heimweg. Unterwegs aber begann es in meinem Hirn zu arbeiten: Langweiler? Stubenhocker? Ich? Aber je mehr und länger ich über mich selber nachdachte, desto mehr musste ich vor mir selber zugeben: Ja, ich bin tatsächlich ein langweiliger Bünzli. Oder was Besonderes hatte ich denn in meinem Leben schon geschaffen oder gemacht? Früher, ja, in meiner Jugendzeit, da hatte ich noch Träume, Vorsätze und Wünsche. Damals, ja damals las ich noch so wunderbare Heldentaten von einem Amundsen, von einem Scott, von einem Christoph Kolumbus. Und auch später hatte ich noch meine Vorstellungen. Aber all diese Wünsche und Vorsätze waren in den Jahren der Berufsarbeit und mit den Pflichten des Gatten, des Vaters und des Vereinskollegen vergessen gegangen. Kein neuer Kontinent entdeckt; keine neue Galaxien und keine 8-Tausender im Himalaja erobert. Ja, wenn ich wenigstens ein paar Zehen abgefroren hätte wie der Reinhold Messmer. O.K., das hätte ich ja eigentlich auch gar nicht gewollt. Und eigentlich plagierte der Reinhold Messmer ja nie mit seinen abgefrorenen Zehen; ja, es schien ihm wohl sogar eher peinlich zu sein, dass ihm, dem berühmten Himalaja-Kraxsler solches passieren konnte. Aber so einen verrückten Bart hätte ich mir doch wenigstens wachsen lassen können, damit ich etwa so aussah, wie man sich einen grossen Abenteurer vorstellt? Inzwischen war ich einige Dutzend Kilometer gewandert ohne mir dessen bewusst zu werden; ich sah weder die schönen Blümchen am Wegesrand, noch hörte ich die Glocken der weidenden Kühe und Kälber, noch roch ich den wunderbaren Duft der Gülle, die ein Bauer direkt neben mir mit seinem Druckfass auf die Wiese spritzte. Erst als ich auf dem Feldweg in eine braune Pfütze trat und die Brühe mir in die Schuhe lief, kam ich wieder zu mir selber. Ich riss mich selber aus dem unsinnigen Sinnieren und befahl mir selber, mich wieder um das Drumherum zu bekümmern.
- 6. 4 Zuhause angelangt goss ich mir zuerst mal ein Glas Bier in einem Zug die ausgetrocknete Gurgel hinunter. Dann sah ich die Flasche mit dem köstlichen Birnenschnaps, den ich auf einer meiner Wanderungen einem Bauern abgekauft hatte, weil der gerade am Schnapsbrennen war und mir ein Gläschen zum Verköstigen anbot. Seither waren Jahre vergangen, ohne dass ich mal eine würdige Gelegenheit gefunden hätte, die Flasche zu entkorken. Heute aber schien nun diese würdige Gelegenheit endlich gekommen zu sein. Ahhhhhh, der erste Schluck war wirklich himmlisch – und brannte so teuflisch die Kehle runter. Und ich konnte meinen Schutzengel voll verstehen, der seinen grossen Kummer mit solch „scharfer Munition“ bekämpfen musste. Nach dem zweiten kam noch ein drittes Gläschen Birnenschnaps. Dann ging ich Duschen und, weil es draussen inzwischen dunkel geworden war, schlüpfte ich in die Federn. Wie ein Stein schlief ich. Aber ich musste wohl ganz übel geträumt haben, mehrmals schrak ich auf, in Schweiss gebadet und mit Brummschädel. Etwa um 3 Uhr hatte ich ausgeschlafen und begann zu sinnieren: Hatte ich denn nicht soeben geträumt, ich sei als Astronaut auf dem Mond gelandet? Es war mir, ich röche noch den Mondstaub, der mir beim ersten Schritt auf dem Erdtrabanten um den Kopf gewirbelt war und mir die Sicht auf die Steinbrocken und Felsen im Hintergrund verwehrte. Und hatte ich nicht soeben laut „Huston, wir haben ein Problem!“ gerufen? Und hatte ich nicht noch soeben das Kichern des Mannes im Mond gehört, der bei meiner Landung hinter einem dieser Felsbrocken verschwunden war? Und da war doch noch ein anderer Traum: Ich hing im Himalaja an einer steilen Felswand. Über mir sah ich einen Felsbrocken sich lösen; er fuhr mir haarscharf am linken Ohr vorbei und landete unter mir auf einem Felsenband, auf dem ein Adlerpärchen seine Jungen fütterte. Aufgeschreckt flogen sie hoch, sahen den hilflos im Seil Hängenden, umkreisten ihn mit schrillen Schreien und zogen ihre Kreise bedrohlich immer enger. Sollte ich hier wohl das Ende jenes griechischen Helden wiederholen müssen, dem die bösen Raubvögel die Leber immer und immer wieder aus dem Leibe frassen, derweil diese Leber ihm täglich wieder nachwuchs? Und während diese bösen Träume langsam wieder verblassten, kamen neue bruchstückweise in mein waches Bewusstsein. Aber sie waren wirklich so bruchstückhaft, dass sie insgesamt keinen Sinn mehr ergaben. Aber ich merkte, dass mir da wohl jemand oder etwas einen Fingerzeig geben wollte oder musste. Vielleicht war es ja mein schrulliger, frustrierter Schutzengel, der mir einen letzten Liebesdienst erweisen wollte, bevor er seinem Arbeitgeber seine Demission einreichen wollte? Fazit der Träumerei: Etwas in meinem Leben musste ich ändern. Aber was? Ich konnte mir ja nicht ein paar Zehen abfrieren lassen wie der Reinhold Messner oder ein Ohr abschneiden wie der Vincent Van Gogh, oder? Aber irgendetwas, irgendetwas ganz Verrücktes musste ich tun, das wusste ich und es
- 7. 5 liess mich nicht mehr ruhen. Und endlich kam mir die zündende Idee. Und ich wunderte und ärgerte ich, dass mir diese Idee nicht schon längst bewusst geworden war, musste sie doch schon Jahrzehnte lang in mir geschlummert haben. Flugs sprang ich aus dem Bett und setzte mich an meinen Computer: Etwas Verrücktes, ja etwas ganz irrsinnig Verrücktes kam über mich: ich begann zu schreiben. Und was glauben Sie wohl, was ich da in die Tasten haute? Richtig: Diese Geschichte!
- 8. Eine aussergewöhnliche Begegnung Ich bin bei Musik Hug St. Gallen Abteilungsleiter Klaviere/Flügel und Keyboards(Tasteninstrumente). Daneben habe ich mit Hrn. Eddie Lüber, der die Piano- Reparatur-Werkstatt führt, eine anerkannte Persönlichkeit in der Restaurierung von ‚ historischen Tasteninstrumenten wie Cembalos, Clavinettes, Harpsichords und Hammerflügel. Man kennt Ihn in ganz Europa. Wir schreiben das Jahr 1987. Eines Tages morgens im Herbst(es ist neblig) hält ein Lastwagen der Firma Berger Transporte bei uns an der Spitalgasse. Zwei Männer verlangen nach mir und wollen ein offensichtlich desolates Tasteninstrument ausladen. Ich bin überrascht. Denn ich habe keiner Transportfirma den Auftrag für eine Abholung eines für mich völlig unbekannten Instrumentes aus Basel gegeben. Herr Lüber ist gerade nicht im Hause, denn er ist ausser, neben seinen fachlichen Qualitäten Auch ein ausgezeichneter Klavierstimmer. Und gerade in einer Musikschule am stimmen. Also entscheide ich, dass die Transporteure das unbekannte Objekt in die Werkstatt stellen sollen. Dann muss ich aber wieder zurück in mein Büro, denn das Telefon klingelt. Ein Kundengespräch. Am Nachmittag als Herr Lüber seine Stimm-Tour beendet hat, finden wir zwei endlich Zeit miteinander zu sprechen. Jeder von uns meint, dass der andere den Auftrag für dieses Im Moment noch unbekannte Tasteninstrument gegeben hat. Es wird im Gespräch offensichtlich, dass weder Hr. Lüber noch ich, oder die Firma Hug von einem solchen Auftrag weiss.! Einen Tag später nach der unerwarteten Lieferung, haben wir endlich Zeit das unbekannte Objekt genauer in Augenschein zu nehmen. Mit Kennerblick und bedeutungsvollem Kopfschütteln erhalte ich von Hrn. Lüber die Facts. 1. Das Instrument ist wirklich eine Rarität. 2. Es stammt aus dem 15. – 16. Jahrhundert 3. Es ist ein Cristofori-Cembalo. 4. Der Zustand ist katastrophal. Details: Die Tastatur ist zum grossenteil feucht, angemodert, es fehlen wichtigste Teile zur Bewegung der Tasten. Hammer und Kapseln. Hebeglieder sind in der 2. Oktave fehlerhaft, vermodert oder sonst desolat. 5. Das Instrument ist nicht spielbar. Daher meine Ueberlegung, was mache ich mit dem unbrauchbaren Objekt……… Das Holz des Cembalos besteht aus massivem Wurzelmaser und war zu dieserZeit sehr in Mode. Herr Lüber fühlt sich beim Anblick dieses historischen Instrumentes nicht recht wohl. Ich merke es an seinem eigenartigen Benehmen. Als er über das Instrument streicht schüttelt er wieder den Kopf. Ich frage ihn was ist los mit diesem Instrument? Wörtlich nach längerem Zögern schaut er mich fast verlegen an und meint, dieses Instrument strahlt eine unglaubliche Kälte aus. Es schaudert mich wenn ich es berühre. Jetzt ist es an mir zu staunen. Herr Lüber geht es ihnen nicht gut, dann gehen sie besser nach Hause und ruhen sich mal aus. Nein, nein mit mir hat es nichts zu tun. Es ist einfach dieses Objekt, das mir Sorgen bereitet. Sagt er. Ich werde mir heute Abend die Zeit nehmen und jede einzelne Taste markieren und mit Zahlen und Zahlenschlüssel versehen. Dann werde ich bei der Firma J.C. Neupert in Deutschland die fehlenden Teile bestellen und das Instrument eventuell restaurieren.
- 9. Stop, sage ich. Das müssen wir noch einstweilen verschieben, bis sich der wirkliche Auftrag- Geber meldet. Ich werde jedenfalls unseren Filialleiter informieren. Ich spreche mit unserem Filialleiter Hrn. B. Pfister. Er informiert Frau Erika Hug. Vier Tage später Nach der Filialleiter-Sitzung in Zürich informiert mich Hr. B. Pfister bei der Rückreise von Zürich nach St. Gallen telefonisch, das dieses Instrument restauriert werden soll, komme was wolle. Es gibt in St. Gallen ein Museum für historische Tasteninstrumente. Falls sich der Auftraggeber nicht meldet. wird dieses Instrument auf Kosten von Musik Hug restauriert, wenn es nicht restauriert werden kann bringt es im Museum auf jedenfal so oder sol gute Werbung für Musik Hug. Jetzt möchte ich wirklich endlich mal wissen, wem dieses musikalische Kleinod gehört hat. Also rufe ich die Firma Berger, die den Transport ausgeführt hat an. Als ich den offensichtlich verlegenen Chef am Telefon habe. Bekomme ich als Antwort etwas so unglaubliches zu Hören, wie der Transport deses unerwarteten Objekts. Der Auftraggeber sei eine Dame. Jedenfalls die Stimme war weiblich. Sie hat eine genaue Beschreibung wo das Instrument jetzt steht, uns gegeben. Dies alles höre ich gespannt von Hrn. Berger. Als wir dort ankommen, stehen wir verdutzt vor einem alten Haus das jetzt endlich abgerissen wird., dies Gebäude war für den Abbruch schon vorbereitet,das mitten in Basel schwierig die Zufahrtund mitten in der Altstadt.Meine Leute hatten keine Freude, das kann ich Ihnen sagen. Das Gebaude stammt aus der Zeit des Rokkoko. Und soll herrschaftlich gewesen sein. Man sagt, dass dieses Haus sei unheimlich, verhext mit einem schrecklichen Unglück belastet.. Es wäre gruslig und niemand hätte Lust dort zuwohnen also steht es seit Jahrzehnten leer.. Dies alles erfahre ich über Umwege. In den Analen findet Hr. Lüber eine Geschichte die uns beiden nicht behagt. Dieses Instrument hat eine schreckliche Bluttat erfahren. Als wir dies alles wissen fällt plötzlich eine ungewisse Unruhe über mich und Hrn.E. Lüber. Wir beschliessen den Filialleiter über alles zu informieren. Als wir unseren Filialleiter informieren, meint er süffisant, das hält uns nicht davon ab das instrument zu restaurieren ‚ gälledsi Herr Lüber, mer bschtelled diä Teili bim Neupert.’ Herr Lüber lacht einbischen verlegen und informiert den Chef von Hug St. Gallen, dass er alles nötige zur Wiederherrstellung des Instrumentes veranlassen wird, und bei der Firma J.C. Neupert in Nürnberg sämtliche fehlenden Tasten in originaler Form wie auf Bildern über das Cristofori Cembalo zusehen sei bestellt, und verlange , dass die weissen Tasten Elfenbein sein müssen. Auch sei der Tastenschlüssel unbedingt genauso zu berfolgen wie es der Auftrag (Hrn. E. Lüber) verlange.. Das freut Hrn B. Pfister. Er entfernt sich wieder aus der Werkstatt um anderen Dringlichkeiten nach zugehen. Als ich mit Hrn. Lüber wieder alleine in der Werkstatt bin zeigt er mir schweigend etwas für ihn unglaubliches…. Mit zittternder Hand weist er auf einen grösseren dunklen Fleck im Stimmstock hin und meint Das hätte sich richtig eingefressen und lasse sich nicht mal mit Bienenwachs-Oel entfernen. Was meinen Sie? , frage ich Ihn. Es könnte Blut sein, murmelt er vor sich hin.Er schüttelt wieder den Kopf. ‚Aber Hr. Lüber, das kann ich nicht glauben, dass so etwas nach so langer Zeit, noch sichtbar sein soll? Sage ich zu ihm. Als ich am Abend wieder in die Reparaturwerkstatt gehe, um abzuschliessen. Sitzt Hr. Lüber immer noch gebeugt vor dem desolaten Objekt und zeichnet beharrlich und genau den wichtigen Tastenschlüssel auf. Taste, Zahl, Taste, Zahl usw.
- 10. ‚Es ist jetzt schon halb Sieben abends Hr. Lüber’, sage ich und entwinde ihn seiner filigranen Arbeit. Kommen Sie, wir gehen noch etwas Trinken und dabei Können wir uns unterhalten, ich lade sie ein. Nach 2 Bündnerteller und reichlich Wein, ist Hr. Lüber in der Stimmung, um mir zu erzählen, das er Nachts von diesem ‚verfluchten Instrument träumt.’ Als ich mit Ihm das Gasthaus verlasse. Geht jeder in Gedanken versunken nach Hause. Nun sind es schon 10 Tage her. Es meldet sich niemand. Die offene Rechnung für den Transport habe ich inzwischen zur Zahlung frei gegeben. Es ist Donnerstag. Die Firma Kraus & Papst hat von Nürnberg endlich die benötigten Teile gebracht. Und nach dem filigranen Plan von Hrn. Lüber, steht nun ein Duplikat der Tastatur in Elfenbein in der Werkstatt. Wir überprüfen den Tastenschlüssel und die Zahlen. Es stimmt perfekt. Herr Lüber misst die Oktavsteller aus’ die Measure stimmt. Es liegt alles bereit für den Einbau.!!!!!!!!!!!! In den 10 Tagen hat Hr. Lüber das Aussengehäuse stabilisiert aufgefrischt und poliert. Der Mahagoni u. Wurzelmasser haben sich wunderbar ergänzt. Die Stukatur ist herrlich geworden. Der Name Cristofori ist deutlich und klar ersichtlich. Nur der Stimmstock ist noch im selben Zustand wie bei der Anlieferung. Der grosse dunkle Fleck ist immer noch zusehen. Nun das Ende mit Schrecken oder soll ich sagen Horror oder eher wie die Priester Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde als sich unsere Schulweisheit träumen lässt.!!!!!! Am Freitag morgen ruft mich Hr. Lüber aufgeregt und mit zitternder Stimme in die Klavierwerkstatt. Seine Hände zittern und er muss seine Herztropfen nehmen. Herr Lüber ist seit einem Jahr in Behandlung wegen eines Herzinfarktes. Die neue Tastatur ist weg!! Gestern Abend beim Verlassen haben wir beide noch die Tastatur mit feinem Karton Zugedeckt und angeschrieben: ‚neue Tastatur’. Dann haben wir die Reparaturwerkstatt abgeschlossen und ich habe die Türen zur Piano-Abteilung ebenfalls abgeschlossen und sind dann nach Ladenschluss nach Hause gegangen. 1. Ich informiere den Filialleiter. O Schreck lass nach meint er, ich muss Frau Hug informieren. 2. Der Hauswart muss antraben. Wir quetschen ihn aus. Er ist auch zugleich der Chauffeur für Musik Hug St. Gallen und fährt alles mögliche mit dem VW-Bus. 3. Die Putzfrauen werden gefragt. Sie haben die Tastatur nicht gesehen. Ich erkläre ihnen, dass die Tastatur in einer dünnen Kartonverpackung auf dem restaurierten Instrument gelegen hat. Das Cembalo haben sie sofort gesehen, aber nicht die Tastatur!!!??? 4. Der Hauswart ruft bei der Müllabfuhr an sie erlauben uns den Papier- Kehricht von der Musik Hug AG (Inhalt des Containers zu durchsuchen) Wir finden nichts, Kein Karton, keine Schachteln Keine Tastatur.!!! 5. Es ist zum Verzweifeln. Wie kann so etwas geschehen, von Donnerstag Nacht auf Freitag morgen. Ich gehe durch alle Abteilungen von der Notenabteilung bis zur Plattenabteilung dann durchsuche ich alle Kartons meiner Orgelabteilung. Nichts! 6. Die Klavierwerkstatt stellen Hr. Lüber und ich auf den Kopf, nichts ist zu finden.
- 11. **Hrn. Lüber geht es schlecht ich schicke Ihn sofort nach Hause und informiere den Filialeiter. Der Wind könnte dieses sehr leichte Material schon wegblasen. Aber nirgends auf dem Boden oder auf dem Arbeitstisch, deutet daraufhin, dass der Wind die Teile wegblasen haben könnte. Das Fenster war einwenig geöffnet. Aber ein Dieb hätte keine Möglichkeit gehabt einzudringen. Denn die Klavierwerkstatt befindet sich unter dem Boden der Hauptstrasse Spitalgasse/Marktgasse.. Die Gitter sind abgeschlossen. Nur ein Kind wäre fähig in der Spitalgasse in die Kelleröffnung einzudringen. Aber an dieser Strasse rollt immer Verkehr! Die Teile dieser Duplikate sind teuer. Ich will nicht über den Preis sprechen. Der ideelle Schaden der durch den Verlust entstanden ist mit nichts zu vergleichen. Dazu die Krankheit von Hrn. Lüber, seine vielen Arbeitsstunden. Seine nervliche Anspannung gekoppelt mit Unwohlsein mit dem Wissen, das dieses Instrument nicht mehr spielbar ist, falls Hrn. Lüber etwas passiet hängt wie ein Damokles-Schwert über uns. Was ich nicht erwartete, traf ein, Hr. Lüber musste ins Spital eingeliefert werden. Gibt es eine Vorsehung. Soll das Instrument einfach gesagt nicht mehr zu Leben erweckt werden. Soll oder darf dieses einmalige Instrument nicht mehr erklingen. Was wissen wir über Aussergewöhnliches? Ich will vorsichtig beginnen. Ich schwöre,was ich hier nun auf Papier bringe, entspricht der Wahrheit wie die ganze bis dahin erzählte Begebenheit. Es ist Samstag.Hr. Lüber ist nun schon seit 3 Wochen im Kantonspital. Nachher soll er zur Kur irgendwo im Graubünden… Also Samstag ist in der Musikbranche immer ein guter Tag um Verkäufe zu tätigen. Am Morgen sind einige junge Leute in die Keyboards vertieft. Sie spielen was ihnen gefällt. In der Zwischenzeit konnte ich ein Piano vermieten. Eine Familie interessiert sich für einen Flügel. Die eine Tochter spielt schon wirklich gut Klavier. Die Familie ist sehr interessiert. Dann erreicht mich ein Telefon. Als ich abnehme, meldet sich eine Frauenstimme. Die weibliche Stimme möchte das Cembalo, dass bei uns in der Werkstatt steht besichtigen. Sie sei bald da. Als ich nach Name oder Adresse fragen will, wird aufgelegt. Ich komme mir wie im falschen Film vor. Erstens ich kann fast nicht glauben, dass dieses Telefon stattgefunden hat. Ziemlich verwirrt bin ich wieder bei der Familie zurück. Das einzig Gute in diesem Moment ist die Entscheidung des Vaters der Familie, diesen Yamaha C3 180cm Flügel in Miete/Kauf zu nehmen. Ich kläre die Liefersituation, Standort, wieviele Stockwerke, etc. Zum Glück ist es Parterre und erst noch über den Gartensitzplatz zu liefern in ein Einfamilienhaus. Alles Klar. Wir regeln die vertraglichen Bedingungen und der Mann unterschreibt. Ich mache noch den Termin für die erste Stimmung mit der Familie ab. Inzwischen ist es nach 14.00 Uhr geworden. Am Stand hole ich an der Marktgasse ein Sandwich.
- 12. Bemerkung Um zu der Klavier/Keyboard-Abteilung zu gelangen sind bis ins Sousoul zwei Treppenreihen nach unten zu gehen. Ein rüstiger Mann oder rüstige Frau braucht ca. 1 Minute. Eigentlich egal was ich jetzt erklären will entbehrt jeder Logik. Mittlerweile ist es 15 Uhr geworden. Der angesagte telefonische Besuch hat noch nicht stattgefunden. Ich kaue an meinem Bürotisch am diskret eingepackten Sandwich und trinke Kaffee aus dem Papierbecher….. Wie magisch angezogen schaue ich plötzlich zur offenen Treppe hoch. Es erscheint eine Gestalt. Die Kleidung entspricht nicht unserer Zeit. Die Dame trägt eine Art Filzgarderobe mit einer Krinoline. Das Kleid ist dunkel. Die Dame lässt sich nicht bestimmen. Das Gesicht ist nicht richtig erkennbar. Die Augen sind wie leblos. Sie geht nicht die Treppe runter, nein sie hat einen schwebenden Gang das Kleid ist so lange das man die Schuhe oder Füsse nicht sieht. Sie bewegt sich schnell. Zielbewusst steuert sie auf die Türe der Werkstatt zu. Ich öffne die Türe wie im Traum. Dann höre ich die weibliche Stimme, sie sagt ‚dies ist mein’ Dann dreht sie sich um zu mir. Ich muss es ihr sagen irgend etwas drängt mich dazu. ‚Gälled si sie sind nöd würklich’!!!!! Das einzige was ich von dieser Dame höre ist „Sie sind der Satan“. Schockiert über diese Bemerkung versuche ich die Dame zu beschwichtigen. Doch sie ist so schnell weg, dass ich ihr diese Treppenstufen nur keuchend nachfolgen kann, und als ich auf die Marktgasse springe ist die Gestalt verschwunden. Wie in Luft aufgelöst. Ich kann beeiden, dass ich dies im Herbst 1987 in St. Gallen als Abteilungsleiter Klaviere und Keyboards erlebt habe. Nachsatz: Was ist es, wenn wir über Dinge sprechen. Die der Mensch in seiner Einfachheit nicht begreifen kann u/oder will. Claudigat Ingenium, oder es wankt der Sinn. ** Hrn. Eddie Lüber ist ein Jahr später gestorben er hat sich nie mehr erholt.
- 13. ~ 1 ~ Das göttliche Treffen Ich wache auf aus einem Schlaf voller Träume. Ein seltsames Geräusch hat mich geweckt. Meine Augen müssen sich zuerst an das düstere Licht gewöhnen. Die Umgebung wirkt bedrohlich fremd. Ich liege nicht in meiner vertrauten Umgebung. Um meine geschwungene Hüfte schlingt sich ein farbiger Kanga, ein afrikanisches Wickeltuch. Meine Haut ist dunkel und weiblich. Zögernd fahre ich mit den Händen über meinen Körper. Ich habe Brüste und ein ausladendes Becken. Ich bin eine Frau. „Wer bin ich und warum ist meine Haut schwarz?“, frage ich mich selbst. Ich versuche, mich nicht zu bewegen, denn neben mir liegt eine Gestalt, eine fremde Gestalt. Männlich und nach Atem ringend. Er gibt Geräusche von sich wie eine monotone Maschine; er schnarcht. Alles ist mir fremd. Wie kommt er neben mich oder ich neben ihn? Obwohl ich die Augen wirklich geöffnet halte, frage ich mich, ob ich träume. Eher ein schlechter Traum. Ich stecke in einem schwarzen Körper fest. In einem Frauenkörper. In dem Raum, in dem ich mich befinde, gibt es keine richtigen Fenster und nur quer stehende, aneinander befestigte Bretter betonen die Türe. Ich bin nicht im richtigen Leben und alles um mich herum ist falsch. Ängstlich schliesse ich die Augen, um von hier zu verschwinden, mich aufzulösen und irgendwo anders wieder aufzuwachen. In einem anderen Traum. Einem schönen Traum: Eine grosse Eichentüre öffnet sich und ich trete in eine gewohnte Umgebung ein. Der Boden ist mit Marmorfliesen bedeckt und ich schreite darüber wie eine Prinzessin. Ein riesiges Sofa zieht meinen Blick an. Es ist mit dunklem Leder eingefasst. Schwarz wie Ebenholz. Davor steht ein rauchgläserner Salontisch mit einer runden Schale aus Olivenholz darauf. Sie ist gefüllt mit verschiedenen Früchten. Bananen, Ananas, Mangos und Papayas. Ein fruchtiger Duft findet den Weg in meine Nase, das Wasser läuft mir im Mund zusammen. Ich habe alles, was ich mir vorstellen kann, und bin es mir nicht bewusst. Es ist alles selbstverständlich, aber leider nur ein schöner Tagtraum. Ich halte den Atem an und zähle auf zehn, aber nichts geschieht. Das monotone Geräusch liegt immer noch neben mir. Zögerlich öffne ich die Augen und mit Überwindung richte ich meinen Blick auf den Mann. Sein Bauch ist viel zu gross und behaart. Ernsthaft überlege ich mir, aufzustehen und von hier zu verschwinden. Jedoch, wenn ich ihn aufwecke, befinde ich mich dort, wo ich nicht sein will. In einem Spiel von Fragen, die vielleicht niemand beantworten kann. Und wenn ich tatsächlich eine Frau bin und mich nicht mehr erinnern kann? Was war letzte Nacht geschehen? Hatten wir zu viel Alkohol oder Drogen konsumiert? Alles ist möglich. Alles. Obwohl ich mir Mühe gebe, kann ich meine Gedanken nicht an gestern anknüpfen, ich kann sie nicht einordnen. Ganze Sätze fehlen mir und die Worte sind verschwommen. Das Einzige, das mir dazu
- 14. ~ 2 ~ einfällt, ist unmöglich! Das bin nicht ich, das ist nicht mein Leben. Das hört sich irre an. Es ist irre. Das ganze Leben ist irre. Ich sitze im Leben drin, in diesem Zug, der irgendwohin fährt, dabei habe ich keine Ahnung, wo er anhält und wo ich aussteigen möchte. Die Matratze, auf der wir liegen, liegt auf dem lehmigen Boden. Es gibt keinen Tisch und keinen Stuhl und unsere Kleider sind auf dem Boden verstreut. Ein muffiger Geruch umhüllt meine Nase und ich habe das Gefühl, wir befinden uns in einer Hütte, die für Tiere gemacht wurde. Wäre ich ein Tier, vielleicht ein Huhn, wäre es mir in dieser Umgebung wohl. Das Leben kommt mir vor wie schweres Wasser, das wie Regen vom Himmel fällt. Es erdrückt mich, zwingt mich in die Knie und nur auf allen Vieren komme ich vorwärts. Wie ein Tier. Wenn ich es mir so überlege, muss ich sagen, irgendetwas läuft hier falsch. Aber was? Und dennoch. Wäre es nicht schön, nach einer gewissen Zeit der Welt zu entfliehen? Sich in eine andere Zeit zu katapultieren und gleichwohl die Erfahrungen von heute zu geniessen? Oder von gestern. Das monotone Geräusch bewegt sich. Sein Atem hat sich verändert. Es ist die Aufwachphase. Und ich bin mir sicher, etwas Aussergewöhnliches wird jetzt geschehen. Ob ich will oder nicht. Habe ich eine andere Möglichkeit? Mit seinen grossen Augen schaut er mich verblüfft an. Dieser Blick sagt mir: Er kann sich ebenfalls an nichts erinnern. Mit den Fingern reibt er sich den Schlaf aus den Augen oder um mich verschwinden zu lassen. Weil er denkt, es sei immer noch ein Traum. Aber ich bin immer noch hier. „Wo bin ich?“, fragt mich die tiefe Männerstimme. Während er mich sehr genau fixiert. Dabei stellt er fest, dass er hilflos nackt neben mir liegt. Er hält sich die Hände vor seine Blösse und wird sich soeben bewusst, wie sinnlos es ist. Eine Frau und ein Mann gemeinsam in einem Bett. Was gibt es da noch zu verschleiern? „Wer bin ich?“, frage ich ihn, weil ich weiss, dass ich nicht dort bin, wo ich sein sollte. Erstaunt schaut er mich sehr genau an, um sich zu erinnern, was vorgefallen ist. Vielleich steckt in der Erinnerung die Wahrheit. Er faltet die Stirn und ist sich am Überlegen, was das alles soll. Eine Stille durchflutet die Hütte und ich halte den Atem an. „Du bist ich“, gibt er mir zur Antwort. Seine Antwort verwirrt mich, aber verwirrt bin ich, seit ich aufgewacht bin. „Wie kann ich du sein, wenn ich neben dir liege?“ Wie ich es mir gedacht habe, etwas läuft hier falsch. Er sitzt auf und verweilt auf dem Rand der Matratze. Den Kopf in die Hände gelegt, weil die Gedanken zu schwer sind. „Ich weiss, es ist schwer zu verstehen, aber hör mir zu.“
- 15. ~ 3 ~ „Was muss ich verstehen?“, frage ich ungeduldig, weil ich weiss, wie viele Dinge es gibt, die nicht zu verstehen sind. Sie sind ausserhalb unserer Vorstellungskraft. Einen Moment herrscht zwischen uns Schweigen, weil er nach Worten sucht. „Es sind fünf Jahre vergangen“, beginnt er zögerlich. Ich habe keine Ahnung, was er damit meint. „Warum sind fünf Jahre vergangen?“, frage ich ihn erwartungsvoll, weil ich endlich wissen will, was hier vor sich geht. Und er beginnt zu erzählen. „Vor acht Jahren kam ich nach Afrika, weil ich genug hatte von unserer Konsumgesellschaft. Für mich war es hier das Paradies. Herrliche Sandstrände mit Palmen, immer warmes Wetter und lachende Menschen. Aber die Schwarzen hatten auch nicht immer Grund zum Lachen. Grosse Arbeitslosigkeit, Hunger und der Run auf das Geld waren ihre Probleme, fast wie in unserer westlichen Welt. Ich dachte, ich sei im Paradies, aber dies stellte sich als eine Illusion heraus. Ich sass eines Abends an einer offenen Bar und trank zu viel. Die Sonne war am Horizont verschwunden und die Grillen zirpten im Chor. Zu viele Fragen durchflossen mein überreiztes Hirn. Warum nur wird mit dem Älterwerden alles schwieriger? Aber wem wollte ich auch diese Fragen stellen? Ausser dem Barmann war niemand da. Der lachte sowieso die ganze Zeit über mich. Vielleicht, weil ich betrunken war, oder er sah das viele Geld, das ich bei ihm liegen liess. Also konnte ich mein Leid niemandem erzählen, dabei dachte ich, wenn man sein Leid erzählt, lindert man es. Er macht eine Pause, um sich zu vergewissern, dass ich ihm zuhöre. Dabei schaut er mich genau an, mit einem Blick, der mich aufwühlt. „Da dachte ich“, beginnt er wieder, „vielleicht hört Gott mir zu. Warum ich in dem Moment an Gott dachte, wusste ich nicht. Denn ich dachte schon lange nicht mehr an ihn. Erst wenn es uns Menschen schlecht geht, denken wir an Gott.“ Ich richtete mein Blick gegen den dunklen Himmel, der mit vielen Sternen übersät war, und schickte meine Worte hinauf. Wenn es dich gibt, dann melde dich. Ahnungslos bestellte ich den nächsten Drink und der Barmann lachte. Ich nahm einen grossen Schluck und liess den Kopf hängen. Die Augen fielen mir vor Müdigkeit zu. Ich schlummerte ein. „Wer den Kopf hängen lässt, sieht wenig“, weckte mich eine Stimme. „Wer bist du?“, fragte ich den neben mir Stehenden. „Du hast mich gerufen“, gab er mir zur Antwort. „Oh Gott!“, rief ich fast ein bisschen zu laut.
- 16. ~ 4 ~ Der Barmann lachte und ich rieb mir die Augen. Vermutlich war ich in einem Traum oder der Alkohol war schuld. Ich fragte Gott: „Warum ist alles so, wie es ist, und warum bist du schwarz und nicht weiss?“ Er war ein Schwarzer mit einem weissen Bart und kein Weisser, wie es uns immer auf den Bildern gezeigt wurde. Das irritierte mich, weil ich es anders gewohnt war. Jedoch, wer konnte uns mit Gewissheit sagen, wie er aussah? Denn die, die ihn gekannt hatten, lebten längst nicht mehr auf dieser Welt. Also konnte man niemanden nach seinem Aussehen fragen. Wir konnten nur glauben, was uns erzählt wurde. Schliesslich wurde in den mehr als 2000 Jahren viel erzählt. Allerdings haben die meisten eine Meinung und keiner eine Ahnung. „Ich bin Gott und ich bin überall“, gab er mir rechthaberisch zur Antwort. Dabei dachte ich nur: Er muss es ja wissen, wo er überall ist. Ich möchte manchmal auch wissen, wo ich bin. „Warum tut man das, was man tut, das Gute wie das Böse?“ Wie bei einem guten Freund legte er seinen Arm um meine Schulter. Ich nahm ihn fast nicht wahr, weil er sich federleicht anfühlte. „Das Gute verlangt mehr Willenskraft als das Böse und das Böse kommt von meinem Gegenspieler“, gab er mir zur Antwort. „Dem Teufel“, sagte ich und er nickte. Weiter sprach er: „Fast alles, was du tust, ist eigentlich unwichtig, aber es ist doch sehr wichtig, dass du es tust.“ Weise Worte, dachte ich für mich. „Diese weisen Worte sind übrigens nicht von mir“, klärte er mich auf, „sondern von Mahatma Ghandi.“ Gott schaute mich mit seinem durchdringlichen Blick an, als würde er mir in die Seele schauen. Ich sass einfach da und hörte ihm zu. Seine Worte waren Balsam für meine Seele. „Wenn du könntest“, fragte er mich, „wie würdest du die Welt verändern?“ Gott fragte mich, wie ich die Welt verändern würde. Ich war überrascht und dachte über diese mir gestellte Frage nach. Wenn man unter Seinesgleichen war, wusste jeder irgendetwas, um die Welt zu verändern, obwohl es uns ja gut ging. Aber jetzt fragte mich der Mann, der angeblich die Welt in sechs - oder waren es sieben? - Tagen erschaffen hatte. Der Barmann schaute mich an und lachte. Ich bestellte ein Glas Wasser, denn Alkohol hatte ich genug in meinem Blut. Der schwarze Mann mit dem weissen Bart sass neben mir und wartete auf meine Antwort. Vielleicht, wenn ich eine gute Idee habe, kann er sie umsetzen. Ich überlegte mir, wenn niemand Fehler macht, wäre der Welt und den Menschen schon viel geholfen.
- 17. ~ 5 ~ Als ob er meine Gedanken lesen konnte, sagte er zu mir: „Fehler sind wie Berge. Man steht auf dem Gipfel seiner eigenen und redet über die der anderen.“ Ich musste ihm Recht geben, also überlegte ich weiter. „Das Geld abschaffen“, sagte ich ihm mit kräftigen Worten, damit er sie auch sicher hörte. „Nicht schlecht“, seine bescheidene Antwort. „Denn viele Menschen geben Geld aus, das sie nicht haben, für Dinge, die sie nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen.“ Weiter drängte er mich. Ich nahm einen grossen Schluck Wasser und richtete meinen Blick auf den Barmann, dessen Aufmerksamkeit ebenfalls auf mich gerichtet war, als wäre auch er neugierig auf meine Antwort. „Ich würde die Welt verändern“, begann ich, „indem ich eine Menschenrotation vornehmen würde. Alle fünf oder zehn Jahre würde ich die Armen reich machen, die Schönen hässlich, die Dünnen dick und aus Frauen würde ich Männer machen und umgekehrt und aus Weissen Schwarze. Jeder wäre das Gegenteil von dem, was er gerade war. So wüsste jeder, wie es ist, so zu sein, wie man einmal war. Kein Neid würde mehr sein, weil man irgendeinmal wieder so wird, wie man einmal war.“ „Super, sehr gut“, lobte er mich. Ich hätte das Zeug, Gott zu sein, gab er mir lächelnd zu verstehen. Ich musste auch lachen und auch der Barmann lachte. Immer noch. Er nahm seinen Arm von meiner Schulter und die anfänglich federleichte Last, die mich je länger je mehr drohte, zu Boden zu drücken, wich von meinem Rücken. Entspannt hörte ich auf seine letzten Worte. „Geh in die Welt hinaus und liebe alle Menschen, vor allem die, die du hasst. Und denk daran, du ähnelst denen, die du hasst, mehr, als du denkst und darum denkst du, dass du denen, die du liebst, nie ganz nahe bist.“ Er zitierte noch ein afrikanisches Sprichwort: „Du weisst nicht, wie schwer die Last ist, die du selber nicht trägst.“ Der Mann, der neben mir liegt, dessen Name ich nicht kenne, der, wie er behauptet, ich ist, hat aufgehört zu erzählen. Er hat sich zu mir umgedreht und seinen Kopf auf den Arm gelegt. Neugierig schaut er mich an, um mich zu beobachten. Vielleicht, ob er eine Regung in meinem Gesicht entdeckt. Seine Augen bohren sich in meine und er steigt auf der Treppe hinab zu meiner Seele. Tritt um Tritt. Tiefer und tiefer. „Was denkst du über meine Geschichte?“, fragt er mich, weil ich schweige, nachdem er aufgehört hat zu erzählen. Die Geschichte ist unglaublich und es fällt mir schwer, sie zu glauben. Ich weiss daher nicht, was ich ihm für eine Antwort geben soll. Vorausgesetzt, er erwartet eine. Mein Grossvater pflegte immer zu sagen, wenn ich argwöhnisch gegenüber unglaublichen Dingen war: „Du musst nur daran glauben und dann geschehen Wunder.“
- 18. ~ 6 ~ Tatsache ist, ich bin eine schwarze Frau in einer Hütte, in der es nach Tieren stinkt, und neben mir liegt ein Mann, der behauptet, ich zu sein. Schliesslich ist es unwichtig, was ich von dieser Geschichte halte. Ich finde mich mit diesem Schicksal ab, das mir widerfahren ist, und mache das Beste daraus. Möglicherweise habe ich diesen Weg selbst gewählt, also werde ich ihn gehen, bis zum Schluss. Wer weiss, vielleicht wird in einigen Jahren ein Wunder geschehen und ich werde wieder ein Mann sein mit den Erfahrungen und Gedanken einer Frau. Dann werde ich die Frauen als Mann besser verstehen, weil ich weiss, wie es ist, eine Frau zu sein. Gehören nicht alle Dinge zusammen und sind sie nicht miteinander verbunden? Der Mann steht auf und sammelt seine Kleider, die auf dem Boden verstreut sind, auf, um sich anzuziehen. Bevor er die Hütte verlässt, kniet er vor mich hin auf die Matratze, wartet einen Moment und drückt mir einen zärtlichen Kuss auf die Stirne. Er öffnet seine Lippen, um mir etwas zu sagen, und mein Blick ist auf seinen Mund gerichtet, als könnte ich die Worte sehen, die jetzt aus seinem Mund kommen werden. „Wenn du nicht mehr weiter weisst, dann leg ein Ohr auf den Erdboden, somit ist das andere für den Himmel offen. Denn der Himmel und die Erde gehören zusammen wie der Tag und die Nacht.“ Er steht auf und ohne sich noch einmal umzudrehen, verschwindet er aus meinem Sichtfeld.
- 19. 1 Aussergewöhnliche Begegnung - oder was zuviel für Anna Bühler war Die achtzigjährige Anna Bühler trat als Patientin ins Spital ein. Ihr linkes Knie musste durch eine Prothese ersetzt werden.. Sie war nur allgemein versichert. Ihr wurde ein Bett im Viererzimmer zugewiesen Anna Bühler war bekannt in der Stadt als Samariterin, Mitglied des Kirchgemeindera- tes und des Theatervereines. Trotz ihres Alters war sie aushilfsweise als freiwillige Helferin in der Kaffeestube des Altersheimes tätig und begegnete den Leuten stets freundlich und hilfsbereit. Ihr schneller Schritt und ihre geschickte Hand waren ihr Markenzeichen. Ihre humorvolle, optimistische Verhaltensweise in spannungsrei- chen Situationen wirkte wohltuend auf ihre Mitmenschen und brachte ihr ausschliess- lich Sympathien ein. Sie fand immer das richtige Wort zur rechten Zeit und ihre Arbei- ten verrichtete sie trotz ihres Alters speditiv und absolut selbständig und zuverlässig. Der Spitaleintritt wegen der Knieverletzung war für sie ein notwendiges Übel, das sie so schnell als möglich hinter sich zu bringen gedachte. . Bevor die Krankenschwester die Türe zum Patientenzimmer öffnete, um Anna Bühler ins Zimmer zu führen, drang durch diese ein dumpfes Geräusch wie von einem Pressluftbohrer, einer Bandsäge und dem Schnarchen eines Pferdes, das aber au- genblicklich verstummte, als die Schwester die Türe ganz öffnete und die beiden Frauen eintraten. Anna Bühler verstaute ihre Sachen in den ihr zugewiesenen Schränken, entkleidete sich für die bevorstehende Untersuchung durch Labor und Narkosearzt und harrte der Dinge die da kommen sollten. Von den vier Betten war das dem ihren gegenüberliegende bereits besetzt. Darin lag die siebzigjährige Ida Wüest. Sie war schon vor einigen Tagen mit dem Krankenwa- gen direkt von ihrem letzten Kuraufenthalt hier ins Spital auf die chirurgische Abtei- lung eingeliefert worden. Vier Transporthelfer und zwei Krankenschwestern waren
- 20. 2 nötig, um die 135 Kilo schwere Person von der Bahre ins Spitalbett zu hieven. Es gab keinen Bettheber, in welchen die schwabbelnde Fettmasse hineingepasst hätte, berichtete eine junge Praktikantin später Anna Bühler. Anna Bühler war zunächst offen für die neue Situation und humpelte zu Ida Wuest, um sich vorzustellen und die Mitpatientin zu begrüssen, bevor sie ihr eigenes Bett bezog. „Grüss Gott, - ich bin die Anna Bühler und werde morgen operiert. Ich bekomme ein neues Knie! Sie haben es wohl schon hinter sich?“ „Ääch! Ääch! Ääääch!“ Aus einer weit aufgerissenen Mundhöhle kam Anna Bühler einige Male nur ein krächzendes Räuspern entgegen. Ein Arzt kam mit einer Pflegerin ins Zimmer und stellte Ida Wüest und der zuständi- gen Pflegefachfrau noch einige Fragen. Sie war demnach 1.53 Meter gross und 151 Kilo schwer. Dieses Gewicht, so sagte sie, hätte sie schon in jungen Jahren gehabt. Sie habe halt immer gerne gegessen. Ihre Mutter habe gut gekocht und Essen sei ihr Lieblingssport gewesen. Trotzdem hatte sie es geschafft, drei Kinder zu empfangen und zu gebären, die ebenso wie sie zu Körperfülle neigten. Die Ärzte wirkten etwas schockiert, was Ida Wüest zu einem verlegenen Gekicher reizte. Neben dem Bett stand Idas Ehemann, dessen Bauch von den Essgewohnheiten der Familie Zeugnis abgab. Sie atmete schwer beim Sprechen, da sie wegen des riesigen Bauches ganz flach liegen musste. Ihr fettes Schwabbelfleisch bedeckte die ganze Bettoberfläche. Anna Bühler sah von ihrem Bett aus nur den grossen Kopf mit struppig kurzem Haar, zwei kleinen Äuglein, dazwischen eine grosse, lange Knollennase und rechts und links davon zwei steile Falten nach unten bis zum Kinn, eingerahmt von dicken Ba- cken. Alles ging halslos direkt in den Brustkorb über. Ab und zu kam ein dicker Arm mit einer unheimlich grossen, fleischigen Hand zum Vorschein, mit der sich Ida Wüest am Bettbügel hochzog und dabei ein lautes Stöh- nen von sich gab. In ihren anderen Arm war eine Infusionsleitung gesteckt und aus der Nase ragte ein Sauerstoffschlauch. Anna Bühler fühlte in sich ein ganz ungewohntes Gefühl von Widerwillen und Antipa- thie hochsteigen, dessen sie sich aber sofort schämte und sich selbst mit den Worten
- 21. 3 beschwichtigte: „Ach die arme Frau, die hat ja schwer zu tragen!“ und sich mit dem Durchblättern einer Zeitung zu beschäftigen Versuchte. . Im Laufe des späten Nachmittags traten zwei weitere , jüngere Patientinnen ein, die am nächsten Morgen an den Schultern auch operiert werden mussten und mit Anna Bühler alsbald im Gespräch Kontakt gefunden hatten. Dann kam der Narkosearzt, machte mit den drei Frauen die üblichen Abklärungen und gab die nötigen Informati- onen für den morgigen Operationstag. Ida Wuest sollte ebenfalls operiert werden. Ihre Abklärungen waren schon am Vortag getroffen worden. Ihr Oberschenkel war spontan gebrochen, als sie sich bei ihrem letzten Kuraufenthalt von einem Stuhl erhoben hatte. Durch die lebenslange Bewe- gungsarmut und ihr enormes Übergewicht waren ihre Knochen defekt und brüchig geworden. Sie lebte seit Jahren von einem „Unfall“ und anschiessendem Kuraufent- halt zum nächsten Sie litt dadurch auch an schwerer Blutarmut und musste mehrere Bluttransfusionen haben. Der dadurch gewonnene Energiegewinn löste aber bei ihr keine neue Initiative aus. Sie erstickte alle Erwartungen an sie gleich mit einem „Das kann ich nicht, das geht nicht, das will ich nicht!“. Ihr gefiel das Leben, so wie es war. Stuhl- und Urin - Entleerungen waren ihr ohne fremde Hilfe nicht möglich. Im Grunde fand sie ihren Zustand selbstverständlich und gar nicht abnormal. Er verschaffte ihr ein bequemes Leben und befreite sie von Verpflichtungen. Ihr Interesse beschränkte sich auf Krankheiten, ihre eigenen und die ihrer Mitmenschen. In Spitälern und Kurhäusern war sie zu Hause. Die Kosten schienen sie nicht zu be- schäftigen. Dem Pflegepersonal und den Mitpatienten gegenüber hatte sie einen freundlichen Umgangston, solange man sie nicht auf Selbstverantwortung ansprach. Da konnte sie sehr giftig werden. Die erste Nacht vor dem Operationstag der drei anderen Frauen brach an. Sie be- kamen nichts mehr zu essen, um für die Narkose nüchtern zu sein. Ida Wuest Bett wurde einwenig hochgestellt, das Tischchen herangerückt und ihr das Essen serviert. Man sah den grossen Kopf hinter dem Bauchberg auftauchen und die fleischige Hand liess Brocken für Brocken in dem, zu einer grossen Höhle gewordenen Mund verschwinden. Dann liess Ida Wuest das Bett mit dem Motor gleich wieder hinunter und man hörte nur Schmatzgeräusche. Dieses Auf und Ab
- 22. 4 wiederholte sich mehrmals, bis sie endlich das Tischchen wegstiess und wieder flach lag. Dann war es eine Zeit lang ganz still. Plötzlich ertönte wie mit einem Paukenschlag der erste dröhnende, unmenschliche Schnarchzug aus Idas Bettecke. Anna Bühler und die beiden anderen Frauen fuhren erschrocken hoch und sahen einander entsetzt an. In periodisch sich steigernden Stössen fuhr Ida Wuest mit dem Schnarchen fort, das, in der Intensität sich steigernd, dem Gebrüll eines Löwen, dem Schnarchen mehrerer Pferde, dem Kreischen einer Bandsäge, unterbrochen durch den lauten Aufschrei eines Säuglings, glich. Eine der beiden jüngeren Frauen drück- te vor Schreck auf die Glocke. Sobald jedoch die Tür sich öffnete und die Pflegerin eintrat, war es in Idas Ecke augenblicklich still! Das Türöffnen musste bei ihr einen Reflex auslösen, der ihren entspannten Schlafzustand und damit das brünstige Schnarchgebrüll sofort unterbrach. Anna Bühler versuchte der Pflegerin zu erklären, um was es da ging. Diese zeigte aber nur ein professionell kühles Mitgefühl, fand, damit müsse man sich im Mehrbett- zimmer einfach abfinden und teilte Schlaftabletten und Ohrenstöpsel aus. Letztere waren überhaupt nicht schalldicht nach aussen und verstärkten nur das eigene Herzklopfgeräusch. Über jedem Bett war ein kleiner Fernsehschirm mit Kopfhörern. Anna Bühler und ihre Mitgenossinnen schluckten brav die Tabletten, schlummerten kurz ein und schreck- ten aber nach kurzer Zeit wieder auf, wenn Idas Schnarchgedröhne einsetzte. Alle zwei Stunden kam eine Nachtschwester und machte die üblichen Kontrollen. Da war es in Ida Wuests Ecke jeweils mucksmäuschenstill, höchstens, dass sie mit der Schwester mit tapfer leidender Stimme ein paar freundliche Worte wechselte. Die drei Operationskandidatinnen zappten sich mangels Schlafmöglichkeit bis in die frühen Morgenstunden durch die Fernsehprogramme und waren froh, als eine nach der anderen abgeholt wurde und sie im Operationssaal in den endlich erlösenden Narkoseschlaf sinken konnten. Kaum erwachten sie nach überstandener Operation am Nachmittag in ihren Betten, mit Infusionsleitungen in den Armen und Kathetern in der Blase, war das erste Ge-
- 23. 5 räusch, das sie hörten, Ida Wuests Geschnarche. das wurde nur unterbrochen, wenn Besuch oder Pflegepersonal ins Zimmer kam. Idas Besuche brachten ihr immer Esswaren mit. Dazwischen waren die drei Frauen der Lärmfolter hilflos ausgesetzt. Sie resignierten, denn niemand nahm sie ernst. Zufolge Idas Schnarchstopreflex konnten sie keinen Beweis erbringen. Die Narkose war für lange Zeit ihr letzter Schlaf gewesen. Schliesslich wurde Ida Wuest’s an und für sich harmloser Beinbruch von einem muti- gen Chirurgen auch operiert. Es dürfte für ihn nicht einfach gewesen sein, durch das Fett der Oberschenkel mit einem Durchmesser von gut einem halben Meter sich bis zu dem Knochen hindurch zu arbeiten. Fünf kurze Stunden waren den drei Frauen Stille und einwenig Schlaf gegönnt. Dann wurde Ida zurückgebracht und das Schnarchen ging mit verstärkter Heftigkeit los. Die Operation ermöglichte ihr erneut absolute Bettruhe und Betreuung von oben bis unten. Anna Bühler und die beiden anderen Frauen mussten bereits am ersten Tag nach der Operation ohne Katheter wieder aufstehen und übten mit allen Kräften und Hilfe von Therapeuten ihre Selbständigkeit. Bei Ida Wuest wurde am zweiten Tag ein Auf- stehversuch unternommen. Zwei Therapeutinnen und zwei Pflegerinnen versuchten, sie an den Bettrand zu heben. Als Ida schliesslich mit weit gespreizten Beinen den Boden berührte, sank sie gleich den beiden Pflegerinnen in die Arme, diese gingen unter dem Gewicht zu Boden. Zwischen Idas Beinen hing die untere Fettschürze bis zu den Knien, während der obere Überhang des schwabbeligen Fettbauches gegen die Nasen der zu Boden gesunkenen Pflegerinnen drückte. Die Alarmglocke wurde betätigt. Schliesslich waren sechs Personen mit allen Kräften beschäftigt, Ida wie- der ins Bett zu ziehen, wo man sie für die nächsten Tage in Ruhe liegen liess und weiterhin von Kopf bis zu den Füssen wusch und ihre Entleerungen besorgte. Nach fünf schlaflosen Nächten konnten die jüngeren Patientinnen das Spital verlas- sen. Die allein in einem Haushalt lebende, alte Anna Bühler musste neun Nächte ausharren. Die beiden Betten waren leer geblieben. In jeder schlaflosen Nacht stei- gerte sich in Anna’s an und für sich menschenfreundlichem Gemüt das Gefühl von verzweifelter Wut, Abscheu und Empörung bis ins Masslose. Eine bis jetzt unge- wohnt heftige Aggression gegen Fettleibige machte sich in Anna breit Ihre Gedanken
- 24. 6 kreisten nur noch um die Erwartung von Idas Schnarchen. Wenn es nachts einmal eine Schnarchpause gab, war Ida mit raschelndem Auspacken von mitgebrachten Esswaren und deren Verschlingen beschäftigt. Es schlug Anna auf den Magen und verursachte Zuckungen in ihren Händen. Die nächtelange Schlaflosigkeit zeigte ihre Folgen. Die zunehmende Aggression weckte in der friedlichen Anna Mordphanta- sien. Jedesmal, wenn Ida Wuest Esswaren auspackte, das Papier raschelnd zu Bo- den fiel und sie schweineartig schmatzend, keuchend und dazwischen hustend und speiend die Sachen verschlang, fühlte Anna Huber in ihren Händen ein Kribbeln auf- steigen, das langsam sich zu einem Krampf entwickelte, der erst Erlösung fand, wenn sich die Hände in einer Art Würgebewegung um einen Zipfel ihrer Bettdecke schlossen. Als Anna in ihrer letzten Nacht auf die Toilette humpelte, ¨überfiel sie, vielleicht zufol- ge der langen Schlaflosigkeit ein Schwindelgefühl. Sie schwankte gegen Ida Wuests Bett. Verschwommen sah sie die grosse Mundhöhle zwischen den dicken Backen, aus der das grauenhafte Geschnarche herausgurgelte. Zwanghaft langte sie vom nebenstehendem, leeren Bett ein Kissen und drückte dieses auf Idas Kopf. Alle Güte, alle Mitmenschlichkeit, alle Vernunft, alle Verantwortlichkeit waren aus dem Gemüt der sonst so liebenswürdigen, geduldigen und humorvollen Frau ver- schwunden. So unvorstellbar es klingen mag, - sie fühlte nur noch Mordlust und Hass. Dabei knickte sie auf ihrem operierten Knie schmerzhaft ein und musste sich eine Weile auf das Kissen abstützen, um sich wieder aufrichten zu können. Dann legte sie wie in Trance das Kissen auf seinen Platz zurück, ging Wasser lösen und begab sich hinkend in ihr Bett. Ein Schwindel trübte ihr Bewusstsein und sie fiel in den frühen Morgenstunden nach neun durchwachten Nächten in einen traumlosen Schlaf. In Idas Ecke war es jetzt still, ganz still. Anna Bühler erwachte, als ein Arzt und einige Pflegerinnen um Ida Wuests Bett leise redend herumstanden und etwas von „cardial.....“ oder so Ähnlichem murmelten. Schliesslich schoben sie das Bett samt der verstummten Ida aus dem Zimmer. Rich- tig wach wurde Anna erst, als es wieder ungewohnt still im Zimmer war. Idas Bett war tatsächlich weg.
- 25. 7 Anna Bühler bekam noch ihr letztes Spitalfrühstück. In ihrem Kopf war eine grosse Leere. Den Albtraum der letzten Nacht mit den möglichen Konsequenzen verdrängte sie. Das Vierbettzimmer gehörte in diesen Momenten ihr alleine. Ganz tief in ihrem Inneren tauchte die Frage „Bin ich eine Mörderin?“ auf. Den Gedanken verdrängte Anna sofort. Sie wollte gar nichts wissen, nichts fragen, nur weg von hier, nur hinaus, nur nach Hause! Anna packte ihre Sachen ein und eine Pflegerin begleitete sie zum Ausgang und wünschte ihr alles Gute. Niemand merkte, dass Anna unter Schock stand. Ein Freund holte sie mit dem Auto ab und brachte sie samt neuem Knie und Krücken heim, begleitete sie noch in die Wohnung und verabschiedete sich rasch. Sie brauchte einige Tage und Nächte, um sich von dem Schnarchtrauma zu erholen. Der vermeintliche Mord blieb ihr Geheimnis. Nach acht Wochen ging Anna wieder zur Arbeit in der Kaffeestube des Altersheimes. Freudig wurde sie von den Kolleginnen begrüsst. Sie wandte sich der Theke zu und sah zu den Gästen. Im Gegenlicht vor dem Fenster sah sie die kegelförmige Rückseite einer sitzenden Person im doppelbreiten Rollstuhl, deren Hinterbacken mindestens zwei Sitzflächen bedeckten. „Wir haben gestern eine neue Patientin für die Pflegeabteilung bekommen. Sie kam direkt aus der Rehabilitationsabteilung vom Spital. Ida Wuest ist ihr Name“, erklärte ihr die Heimleiterin. Anna Bühler erbleichte, fiel in Ohnmacht und verstarb am gleichen Tag an einem Herzinfarkt.
- 26. Mutz mit und ohne... Das Haus, in dem Rena aufuuchs, befand sich an einer Geschäftsstrasse. Die Passanten hatten es immer eilig. Das Mädchen hatte einen lieben Papa und ein herzensgute Mama, aber diese waren als Geschäftsleute immer so beschäftigt, dass sie wenig Zeit übrig hatten für ihre einzige Tochter. Sie war deshalb oft allein und eignete sich dadurch ungeahnte Fähigkeiten an, um sich selber zu beschäftigen. Als Rena dann zur Schule ging, wurde sie oft als Träumerin hingestellt. Nachdem sie das ABC gelernt hatte, war Deutsch ihr Lieblingsfach. In die verlangten Aufsätze konnte sie hervorragend ihre ganze Phantasie und all ihre Träumereien einfliessen lassen. Oft entsprachen die Geschichten aber auch der Wirklichkeit, denn die Eltern bemühten sich sehr, sich wenigstens an den Wochenenden etwas mehr um ihr geliebtes Töchterlein zu kümmern und zeigten ihr die Sehenswürdigkeiten und Schönheiten des ganzen Landes. Demzufolge entstanden dann, unter der immer geübteren Hand von Rena, die reinsten Reiseberichte, und die Lehrer konnten nicht mehr unterscheiden zrarischen Wahrheit und Dichtung. Rena hatte einen äusserst kurzen Schulweg, denn hinter ihrem Wohnhaus befand sich gerade der Pausenplatz und das Schulhaus sowie die Turnhalle. In der grossen Pause konnte Rena das Stück Brot und den Apfel vom elterlichen Balkon aus in Empfang nehmen. Sie wurde flir diesen Vorteil so oft gehänselt von den MitschÜlern, bis sie schliesslich darauf verzichtete. In der angrenzenden Turnhalle waren in der Ferienzeit oftmals Soldaten einquartiert. Eines Tages, während des Krieges, rollten etliche Panzer auf den Pausenplatz. Das musste die momentan unbeaufsichtigte, gwundrige Rena unbedingt sehen und mit- erleben. Sie war so aufgeregt und hatte es eilig hinter das Haus zu kommen - und schon war es passiert. Rena stolperte, fiel hin und schlug den Kopf an einem scharfkantigen Sockel auf. Rena schrie laut vor Überraschung und Schmerz. I,l/l
- 27. Nachbarn eilten herbei um zu helfen. Es war kein schöner Anblick; überall Blut - viel Blut. Die Eltern wurden alarmiert und rannten entsetzt herbei. Ein sofortiger Gang zum Arzt war unerlässlich. Die kleine Rena war so zappelig, dass sie von vier Personen gehalten werden musste beim Nähen der Wunde dicht über dem Auge. Sie hatte eigentlich grosses Glück gehabt bei dem Unfall, aber Rena betrachtete das als grosses Unglück und konnte es fast nicht verkraften. Es war das erste Mal, dass ihr so etwas Schreckliches passierte. Sie verstand die Welt nicht mehr, und obwohl die äusserliche Wunde relativ schnell heilte, war sie immer traurig und zog sich in ein Schneckenhaus zurück. lrgend jemand musste den verzweifelten Eltern einen guten Tip gegeben haben wie man diese fast unerträgliche Situation ändern könnte, denn eines Tages tauchte ein kleines, wollknäuelartiges Wesen auf; ein heziges Kätzlein. Da hellte sich das Gesicht von Rena schnell wieder auf und sie kroch nach und nach aus ihrem Schneckenhaus heraus. Bisher hatte sie nur mit steifen Puppen gespielt, nun hatte sie etwas Niedliches, Lebendiges zu betreuen. Trotzdem das Büsi schwarz-weisse Farbe aufwies, erinnerte es mit seinen langen seidigen Haaren an einen Bärimutz und so wurde es kurzerhand Mutz getauft und von nun an so gerufen. Besonders auffällig war der buschiger Schwanz der kleinen Katze. Der sollte ihr später helfen, vom immer etwas offen gelassenen Küchenfenster aus, über einen etwa zwei Meter breiten Durchgang, auf Nachbars niedriges Dach zu springen, sich mit samtigen Pfoten hinunter zu tasten und über eine Holzbeige hinab zu steigen. Auf dem gleichen Weg kam sie auch wieder herein; wahrhaft ein Meisterstück! Und so hatte die Katze die Freiheit, ein und aus zu gehen wann immer sie wollte. Für ihr Fressen machte Mutz alles. Ein- bis zweimal die Woche kam sie in den Genuss von Lunge, die Rena beim Metzger kaufen durfte. Diese war in einem dünnen, stark knisternden Papier verpackt. Nach kurzer Zeit kannte Mutz dieses -7 L-
- 28. Geräusch und man konnte sie damit in Windeseile in den 2. Stock des Hauses hinauf locken und in die Küche, wo in einer Ecke ihr Fressrrapf stand. Manchmal wurde diese Reaktion auch missbraucht, und Mutz wurde durch knittern einer Zeitung hinauf gelockt, auch wenn nur Hörnli in ihrem Teller waren. Es klappte jedesmal. Papa und Rena liebten das putzige Tier abgöttisch, Mama war nicht so begeistert. Mutz war zwar stubenrein, aber immer wenn sie ein oder zwei Nächte weggeblieben war, also nach der ,,Katzenhochzeit", wollte sie ein paar Tage nicht mehr ins Freie gehen für ihre Notdurft. Mama fand dann jeweils die Bescherung ziemlich schnell. Als dann offensichtlich wurde, dass Mutz bald Mutter werden würde, gewöhnte man sie ganz eindeutig an einen kleinen Wäschekorb, mit alten, sauberen Decken gepolstert, in einem Raum im Untergeschoss. Da auch dort das Kippfenster immer ein wenig geöffnet war, hatte Mutz diese Bleibe schon früher ausgesucht, wenn sie nicht gestört werden wollte. Was lag näher, als ihr dort das Kinderzimmer einzurichten. Mutz war eine gutmütige, anhängliche Katze und war offensichtlich zufrieden mit ihrer Betreuerin, dem Mädchen Rena. So war es nicht venruunderlich, Dass Mutz Rena auf die nahende Geburtsstunde aufmerksam machte. Sie schlich auffällig um die Beine des Mädchens, miaute und lockte Rena richtiggehend ins Untergeschoss. Mutz wollte Rena ganzeindeutig bei der Geburt der Kätzchen dabei haben. Freudig unterrichtete Rena die Eltern vom bevorstehenden Ereignis und diese gaben ihr den Rat, wenn Mutz es zulassen würde, sollte ihr Bauch mit sanftem Druck gestreichelt werden. Die Katze war dankbar für die Hilfe und blinzelte Rena im Halbdunkel zu und schnurrte sogar zwischen zwei Geburten. Es brauchte viel Geduld, aber am Schluss lagen vier feuchte, blinde Wollknäuel neben Mutz. Man brachte ihr schwachen Milchkaffee mit Brotbrocken ans Wochenbett, aber nach zwei Tagen bestand sie darauf, wieder an ihrem angestammten Platz zu fressen. -)
- 29. Von nun an wusste man genau, wo man Rena suchen musste. Sie verbrachte ihre ganze Freizeit im Untergeschoss und beobachtete genau die Entwicklung der kleinen Wesen. Mutz war eine gute Mutter und betreute ihre Nachkommen vorbildlich. Nach etwa einer Woche öffneten sie die Augen und begannen sich tolpatschig zu bewegen. Nun konnte man auch schon erkennen in welcher Farbe sie gezeichnet waren. Es waren ganz verschiedene: ein ganz schwarzes, ein schwaz-weisses, wie die Mutter, und zwei getigerte. Mit grossem Interesse verfolgte Rena die Fortschritte der Katzenkinder und natürlich kamen sie auch in ihren Aufsätzen vor. Das Mädchen hatte viel gelernt beim genauen Beobachten der Aufzucht der Jungtiere, unter anderem auch, dass man sich im Leben immer wieder von etwas Liebgewonnenem trennen muss. Die nun selbständig gewordenen jungen Katzen mussten an Freunde und Bekannte weitergegeben werden. Bei einem totalen Umbau des Hauses musste die ganze Familie für etwa ein Jahr in ein Häuschen in einem anderen Quartier umziehen. Zwischen den beiden Wohnorten lag eine viel befahrene Strasse und die Bahnlinie. Die vorübergehende Bleibe lag am Rande des Dorfes und war von einem Garten umgeben. Auf dem Nachbargrundstück standen Obstbäume und es war viel ruhiger dort. Das gefiel natürlich nicht nur Rena und ihren Eltern ausserordentlich gut, sondern auch Mutz. Sie konnte auf Bäume klettern, sich im Garten tummeln oder dort an der Sonne dösen. Sogar Mäuse konnten mit einiger Geschicklichkeit gefangen werden. War das ein Katzenleben! Nur allzu schnell kam die Zeil, da man wieder in die Dorfmitte zügeln musste, weil die Renovation abgeschlossen war. Mutz war verständlicherweise gar nicht einverstanden damit, und zwei Tage später war die gute Katze unauffindbar. Nach zwei weiteren Tagen machte sich die ganze Familie auf, das geliebte Tier zu suchen.
- 30. Ob es wohl Mutz in das herrliche Revier mit Bäumen und Mäusen zurückgezogen hatte? Aber das schien unmöglich; - die Strasse, die Bahnlinie und der weite Weg. Doch siehe da, Mutz kam nach einigem Rufen aus einem Schlupfwinkel jener Gegend. Wahrscheinlich war sie froh, dass man sie gefunden hatte, und sie trottete gemächlich hinter ihrer Betreuerin her, den ganzen Weg zurück ins Dorf. Mutz wiederholte den Ausflug noch mehrere Male, und es war schon zum Ritual geworden, sie zurück zu holen. Manchmal lief sie auch voraus und wahrscheinlich hätte sie den Weg auch allein gefunden. Mutz wurde älter und ihre Eigenheiten immer ausgeprägter. Sie sass gerne vor der Tür am Hauseingang und beobachtete die Leute die vorbei hasteten. Wegen des nahen Schulhauses war es auch der Heimweg vieler Kinder. Diese wollten das herzige Büsi immer streicheln, aber das liebte Mutz gar nicht. Sie wehrte sich, indem sie die Schüler in die Hand biss. Das ging solange, bis sich Beschwerden von der Schulbehörde und den betroffenen Eltern häuften. Wie sollte man das Problem lösen? Einsperren konnte man Mutz nicht, einschläfern wollte man sie nicht. Sie war Rena und ihrem Papa so ans Hez gewachsen. Aber es kamen immer wieder böse Reklamationen und man mussfe sich von Mutz trennen. Zum Leidwesen von Rena entschied Papa, das sonst gutmütige Tier bei entfernt Verwandten auf dem Bauernhof einzuquartieren, wo man es vielleicht gelegentlich besuchen konnte. Das neue Heim von Mutz lag etwa 30 Km entfernt. Ein grosses Stück Wald und der Fluss lagen dazwischen. Am nächsten Wochenende, als man nach der liebe Katze sehen wollte, bedauerten die Verwandten, sie hätten Mutz am nächsten Tag nicht mehr gefunden und seither sei sie verschwunden. Rena war sehr traurig, als Mutz auch in den nächsten Tagen nicht zu finden war. Sie wollte nicht wahr haben, dass ihr Liebling so mir nichts - dir nichts wie vom Erdboden verschluckt sein sollte. Es dauerte eine geraume Weile bis sie sich halbwegs damit abfinden
- 31. konnte, aber da war nichts zu machen, Mutz war und blieb verschwunden. Rena und ihr Papa verdrängten die Gedanken an Mutz nach dem Motto ,,die Zeit heitt Wunden". Nach etwa einem Jahr sass plötzlich eines morgens eine Katze vor der Haustür. Sie machte einen sehr verwilderten Eindruck und duckte sich ständig, aber sie glich Mutz wie eine Zwillingsschwester. Beim Erwähnen des Namens miaute sie leicht und stand auf. Oh weh, was für ein schrecklicher Anblick! Das arme Büsi hatte keinen Schwanz mehr, sondern nur noch einen Stummel. Mein Gott, was muss diese arme KaEe wohl durchgemacht haben! Rena und die anderen Familienmitglieder rätselten, ob es sich hier um Mutz handeln könnte. Man musste es testen! Als ihr die Tür einladend geöffnet wird schleicht sie, immer noch geduckt, die Treppe hinauf in den zweiten Stock. Sie geht schnurstracks in die Küche und auf den Platz zu, wo früher ihr Fressnapf gestanden hatte. Nun bestanden keine Zweifel mehr; das konnte nur Mutz sein. Welche andere Katze würde sich so gut auskennen. Rena hüpft vor Freude und fällt allen um den Hals. Sie ist überglücklich, sie hat ihren verloren geglaubten Liebling wieder. Am nächsten Tag funktioniert sogar der alte Trick mit dem Fleischpapier. Sehr erstaunt waren allerdings alle, als Mutz den Zweimetersprung vom Fenstersims zum Nachbardach wagt, wo man doch sagt; Katzen würden ihre Sprünge mit dem Schwanz steuern. Rena und Mutz, ohne Schwanz, durften noch ein paar glückliche Jahre miteinander verbringen. Fremden Menschen jedoch wich das malträtierte Büsi fluchtartig aus. Ob ein bösartiges menschliches Wesen der Katze dieses Leid angetan hatte, oder ob es ein Unfall war? Rena würde es nie erfahren.
- 32. 1 Eine aussergewöhnliche Begegnung (Begegnung mit der Ewigkeit) Ich schrak aus einem Traum hoch. Mit geschlossenen Augen blieb ich unbeweglich liegen. Der Eindruck der inneren Bilder lastete schwer auf mir, mein Puls raste. Unbehaglich horchte ich in mich hinein, versuchte mich an das Traumgeschehen zu erinnern. Langsam materialisierte sich eine Szenerie vor meinem inneren Auge: Ich sah mich am Fenster stehen. Draussen, in einiger Entfernung, befand sich eine Strasse. Ich sah eine Ambulanz, gefolgt von einer weiteren. Zwei sich nähernde Ambulanzen mit Blaulicht. Dieser mein Traum machte mich frösteln. Ich holte tief Luft, wollte mich entspannen, doch das ungute Gefühl wich nicht von mir. An Schlaf war nun nicht mehr zu denken, so stand ich auf und trat ans Fenster. Hauenstein, eine kleine Passgemeinde im Solothurner Kettenjura, lag noch ganz verschlafen im diffusen Oktoberlicht. Von der Rankwog über das Rankbrünneli krochen Nebelfetzen das Trimbacher Tal herauf, zogen in rascher Folge an den Behausungen der Menschen vorüber. Ab und zu war ein Blick auf eine blasse Sonnenscheibe zu erhaschen, ehe diese sich wieder in graue Schleier hüllte. Die Nebel ─ getrieben von kühlen Luftströmen ─ rüttelten an Dächern und Fenstern und ich ahnte die baldige Wiederkehr der gefürchteten Herbststürme. Dann endlich, die Stunde hatte soeben zwölf Mal geschlagen, öffnete sich der Himmel, das goldene Herbstlicht kehrte zurück. Ich atmete auf. Wenngleich die Freude am Licht von kurzer Dauer sein würde, da die Oktobersonne die Nebel nur wenige Stunden in Bann zu halten vermag. Ein Hauch von Melancholie lag über den bunt gefärbten Wäldern der Jurahöhen. Die Luft war erfüllt von der betörenden Süsse der Herbstrose, darunter mischte sich als würzige Note der Pilz ─, heimlicher Bewohner des herbstlichen Waldes. Ich nutzte die Gunst der Stunde zu einem Spaziergang. In den Wald wollte ich mit meinem Mann Konrad, das beschauliche Schlendern durch ein Bett aus raschelnden Blättern bereits vor Augen. Es galt, zeitig aufzubrechen, denn die Dunkelheit bricht früh herein über herbstliches Land. Ich wünschte mir eine schöne, eine idyllische Sonntagswanderung, nichts
- 33. 2 Anstrengendes, ohne übermässigen Verschleiss von Kräften. Nur etwas Licht und frische Luft, den Lebensgeistern Gutes zu tun. Hauenstein erstreckt sich in unmittelbarer Nähe der Jurawälder. Weniger Schritte bedurfte es und bereits waren wir im Wald, tauchten ein in dessen dunkles Reich. Der durch die Baumkronen streichende Wind liess das in Rot erglühte Laub in einem anmutig schaukelnden Tanz auf uns herabschweben; wir freuten uns über dieses schöne Bild und hätten am liebsten versucht, wie in Kindheitstagen möglichst viele der Blätter noch im Fluge zu fangen. Wir gingen den Lichtberg entlang nach Unter Wald und zu unserer Rechten, zwischen den Buchen, sahen wir Abschnitte des Dorfes und der Passstrasse. Begleitet wurden wir vom Dröhnen des dichten Ausflugsverkehrs, das sich mit dem Bimmeln der glockenverzierten Kühe zur sonntäglichen Kakofonie mischte. Nach einigen Minuten entspannten Flanierens erreichten wir einen Rastplatz mit kleiner Feuerstelle und drei Sitzbänken. Hier war es ruhig und friedlich, der Lärm der Zivilisation drang nicht an diesen Ort. Einer der Bänke war nahe einem Felsvorsprung errichtet worden und wir nahmen diese Sitzgelegenheit gerne wahr. Tief unter uns verlief das Trimbacher Tal, im Hintergrund blitzten die Fluten der Aare. An klaren Tagen konnte man eine wundervolle Fernsicht geniessen über das Mittelland und die Voralpen bis zu den Eisriesen Eiger, Mönch und Jungfrau. Wir wagten uns vor zur Spitze des Felsens und warfen einen ängstlichen Blick in die Tiefe, dabei malten wir uns aus, wie herrlich es jetzt wäre, einem Vogel gleich abzuheben. Als hätte ihn jemand herbeigerufen, erschien über unseren Köpfen ein grosser Mäusebussard. Die Aufwinde aus dem Tal ermöglichten ihm ein müheloses Gleiten. Ohne mit den Flügeln zu schlagen, zog der Vogel einen grossen Kreis und entschwand wieder unseren Blicken. Sekundenbruchteile später riss uns ein schrilles „pijääh!“ jenseits des Blätterdachs aus unserer gemütlichen Idylle. Ich kannte den Ruf des Bussards, und hierbei handelte es sich klar um einen Alarmruf. Irgendetwas schien den Greifvogel zu beunruhigen. Ich verspürte leises Unbehagen. Schnell stand ich auf, es war Zeit diesen Ort zu verlassen. Vielleicht war es der Schrei des Vogels gewesen, der den Impuls in mir auslöste, unseren Spaziergang nicht in gewohnter Weise fortzusetzen, indem wir den bewaldeten Hügel hinauf zur Frohburg weiterzogen. Stattdessen deutete ich auf einen
- 34. 3 schmalen Pfad, der den Abhang hinabführte. „Seit Jahrzehnten durchstreifen wir die Wälder, diesen Weg jedoch habe ich bislang übersehen. Wohin der wohl führt?“, erkundigte ich mich bei Konrad. Er zuckte mit den Schultern. „Ich kann mich vage erinnern, diese Wegstrecke vor Jahren mal gegangen zu sein, allerdings aus entgegengesetzter Richtung, vom Tale her kommend.“ Augenzwinkernd fügte er hinzu: „Aber das ist eine halbe Ewigkeit her, ich könnte mich täuschen.“ Sein Blick ruhte auf mir. Erneut überkam mich dieser unbestimmte Impuls, der so eigentlich nicht zu mir passt. „Diese Route führt wohl kaum ins Nirgendwo. Finden wir es heraus!“ Es ging abwärts, bereits nach einem guten Dutzend Schritten aber war es, als hätte nie ein Pfad existiert. Die Vegetation hatte das, was einst ein Weg gewesen war, beinahe komplett überwuchert. Wir beratschlagten uns kurz. Sollten wir weiter geradeaus gehen oder eher nach rechts abbiegen, wo ein zweiter schmaler Trampelpfad zu erkennen war? Der Entscheid, auf unserem ursprünglichen Pfad zu bleiben, fiel einstimmig. Zügig ging Konrad voraus. Während ich ihm folgte, hielt ich Ausschau nach geeigneten Holzstecken als Gehhilfe. Der starke Regen der vergangenen Tage hatte das Herbstlaub auf dem Waldboden in eine glitschige Masse verwandelt. Die Stecken waren schnell gefunden und bald waren wir froh darüber, da der Abstieg sich schwieriger gestaltete als gedacht. Steil ging es bergab, und immer wieder sahen wir uns gezwungen, mühselig über flechtenbewachsene Baumstämme zu klettern, die uns wie Schlagbäume am Zoll den Weg versperrten. Hier musste vor einigen Jahren ein schlimmer Sturm gewütet haben, wegen der grossen Anzahl gefällter Bäume. Und der Mensch hatte die Bäume an Ort und Stelle belassen. Ich vermutete, um den zahlreichen Organismen des Waldes Nahrung und Schutz zu ermöglichen. Spechte, Ameisen, Pilze und Moos ─, alle sind sie angewiesen auf Totholz. Über uns ertönte erneut ein Warnruf, dieses Mal war es die raue Stimme des Eichelhähers. Mein Gefühl des Unbehagens war zurück.
- 35. 4 Endlich wurde das Gelände weniger abschüssig und vor uns öffnete sich eine Lichtung am Sockel einer Felswand. Auch hier war der Wald zurückgedrängt worden, sei es durch Sturmschlag oder Menschenhand. Zahllose verstreut umherliegende Felsbrocken bildeten einen anspruchsvollen Hindernisparcours, der unsere Kletterkünste auf die Probe stellte. Vorsichtig balancierten wir über das Gestein und über Reste gefallener Bäume, auf denen üppige Büschel von Stockschwämmchen wuchsen. Ringsum wucherte eine Pflanzenwelt, die an diesem sonnigen Platz vielfältig gedieh. Die Sträucher der Hagebutte, der Vogelbeere und der Himbeere drängten sich auf kleinem Raum und wir kosteten von den reifen süssen Himbeeren. Wir gönnten uns nur eine kurze Rast, die Zeit drängte, zudem fühlten wir uns geradezu bedrängt von der spriessenden Vegetation. Während mein Mann weiter vorausging, hielt er sich mit seinem Stock die von allen Seiten an ihn heranrückenden dornenbewehrten Ranken vom Leib. Auch ich wurde nicht verschont. Immer wieder verlor ich beinahe das Gleichgewicht, da ich mich mit aller Kraft von Schlingpflanzen losreissen musste, die mich wie unsichtbare Fangarme an den Unterschenkeln gepackt hielten. „Zutritt zu diesem Reich ist unerwünscht“, murmelte ich und beeilte mich, zu Konrad aufzuschliessen. Unterdessen stapften wir durch ein Meer aus hohem Gras, abgeblühten Pflanzen und stacheligen Samenkörpern. Ganz in der Nähe erhoben sich die krächzenden Stimmen einer Kolonie Krähen. Immer mehr der ruffreudigen Vögel stimmten ein in das aufgeregte Konzert. Die Wesen in diesem abgelegenen Bereich des Waldes verfügen über ein lückenlos funktionierendes Alarmsystem gegen menschliche Eindringlinge, sinnierte ich. Konrads Stimme riss mich aus meinen Gedanken. „Da vorne ist ein Weg, der diesen Namen auch verdient!“ Die Erleichterung stand ihm im Gesicht geschrieben und auch ich war froh darüber. Wie hätten wir ahnen können, dass die Prüfung erst bevorstand? Der neue, breite Waldweg führte bergauf und wir marschierten los. Schon bald würden wir auf vertrautes Gelände stossen, bald schon… Die Zuversicht beschwingte unsere Schritte. Zwei Minuten später löste sich der Weg buchstäblich in nichts auf. Unmittelbar vor unseren Füssen stürzte eine Erdwand mindestens zwanzig Meter steil in die Tiefe.
- 36. 5 Ernüchtert tauschten wir Blicke. In dieser Gegend gab es verschiedene Deponien zur Lagerung von Schlacken und Bauschutt. Hier also war eine davon, inmitten von diesem verzauberten Stück Wald. Wir sahen hinunter auf die weitläufige Sortieranlage mit den Containern, in denen säuberlich getrennt die verschiedenen Materialien lagerten. In einer Ecke des Deponiegeländes funkelte ein kleiner Weiher. Aus dieser Entfernung sah er aus wie ein Biotop für Amphibien und Reptilien. Wäre schön, sagte ich mir, ein Refugium für bedrohte Arten, und das ausgerechnet in einer Deponie. Einen Moment lang dachte ich daran, mir einen Weg nach unten zu suchen, mich genauer umzusehen. Doch verwarf ich dieses Vorhaben schnell wieder; die Zeit drängte, zudem sind Deponien nichts für Unbefugte. Da wir beide nicht wieder umkehren wollten, suchten wir nach einer Fortsetzung unseres eingeschlagenen Weges. Und tatsächlich entdeckten wir nach einigem Suchen einen Pfad, der die Böschung überquerte. Er war sehr schmal, es bedurfte genauen Hinsehens, ihn als solchen zu erkennen. Erneut ging Konrad voraus. Der Pfad schlängelte sich die Abbruchkante des steil abfallenden Geländes entlang. Oberhalb des Pfades war der Hang übersät mit Gehängeschutt und nur einige wenige kleine Gebüsche fristeten ein kümmerliches Dasein an diesem steilen, unwirklichen Ort. Rund zwanzig Meter schräg über uns begrenzte dichter Wald die Deponie. Sehnsüchtig blickte ich hinauf; die Bäume waren so nah und doch so fern… Wir kamen nur sehr langsam voran, da der instabile Grund wenig Halt bot. Bei jedem Schritt lösten sich Klumpen aus Erde und Gestein, die dumpf polternd in die Tiefe stürzten. Ich widerstand dem Drang, nach unten in die Grube zu schauen. Stattdessen heftete ich meine Augen auf Konrads Rücken, der sich achtsam einen Weg durch das Geröll bahnte. Doch da war etwas, das mich davon abhielt weiterzugehen. Ich war wie gelähmt, nichts ging mehr. Beklemmung kroch mein Rückgrat hoch und ein Gedanke machte sich in meinem Kopfe breit: Hatten wir uns zu weit vorgewagt? Ich warf einen Blick zurück. Nein, ein Zurück war nicht mehr möglich, dazu war es zu spät. Wir befanden uns ziemlich genau in der Mitte der Halde, sodass es keinen Unterschied machte, in welche Richtung wir uns bewegten. Plötzlich empfand ich nur noch Angst, fühlte mich wie eine Katze, die vom Baum gerettet werden muss. Bald würde die Dämmerung hereinbrechen, und wir würden uns gezwungen sehen, die Nacht hier zu verbringen,
- 37. 6 bewegungslos, am Rande des Abgrundes. Das würde das sichere Ende bedeuten. Ich riss mich zusammen. Panik war das Letzte, was ich jetzt gebrauchen konnte. Eine Flut von Gedanken stürmte auf mich ein. Wenn meinem Mann etwas passiert, wenn ich meinen Mann jetzt verliere, niemals werde ich mir das verzeihen!, schoss es mir in den Sinn. Nun barst der Damm, und Panik überschwemmte mich mit nie da gewesener Wucht. Wir spielen hier mit unserem Leben! Diese Erkenntnis raubte mir den Atem, das Herz krampfte sich schmerzhaft zusammen. Wir sind verloren, verloren… war alles, was ich noch denken konnte. Wie in einem Mahlstrom drehten sich die Gedanken im Kreis. In diesem Augenblick brach Konrads Stock mit einem hässlichen Klang. Entsetzt musste ich zusehen, wie mein Mann das Gleichgewicht verlor, zu Boden stürzte, und während er dem Abgrund entgegenrutschte, wühlte er mit seinen Händen im Geröll, verzweifelt nach Halt suchend. Einen Moment später gelang es ihm, sich wieder aufzurichten. Wenige Zentimeter nur trennten ihn vom Abgrund. Er hatte zwei Schürfungen am Bein und eine Schnittwunde an der Hand davongetragen. Aber er lebte. Ich zitterte am ganzen Körper. Das Grauen hielt mich in seiner eisigen Klaue gefangen –, es ist nichts unerträglicher, als hilflos zusehen zu müssen, wie ein geliebter Mensch um sein Leben kämpft! Wir waren dem Tod begegnet, hatten ihm ins Auge geschaut, und ein weiteres Mal würde er uns nicht entwischen lassen, dessen war ich mir bewusst. Nach wie vor waren wir in grosser Gefahr. Wir mussten unbedingt weg von der Geröllhalde. Ich versuchte meine Stimme fest klingen zu lassen. „Wir müssen hinauf zum Wald, hier unten gibt es null Weiterkommen.“ Konrad widersprach mit keiner Silbe und war sofort bei mir. Das Gelände war derart steil, dass wir vor jedem Schritt mit den Schuhen eine kleine Stufe ins Geröll schlagen mussten. Jede Bewegung war eine erneute Herausforderung an das Schicksal. Schwitzend stiegen wir Meter für Meter aufwärts und waren dankbar für die vereinzelten kleinen Gebüsche, an denen wir uns festhalten konnten. Es grenzte an ein Wunder, dass wir es schafften. Endlich schloss sich dichtes Unterholz um uns. Die Geröllhalde hatten wir jetzt zwar hinter uns gelassen, allerdings
- 38. 7 konnten wir uns nicht freuen darüber, da wir uns an einem Ort wiederfanden, der kaum minder unwirtlich war. Das Gelände im Wald war einmal mehr fast senkrecht ansteigend und überall verhinderten liegende Baumstämme ein Fortkommen. Der Schrecken nahm kein Ende. Und wir mussten schnell weiter, bald würde es eindunkeln. Konrad kletterte über das erste hölzerne Hindernis und bot mir seine Hand. Ohne ihn wäre ich verloren gewesen, denn meine Kräfte reichten nicht mehr, um mich ohne fremde Hilfe auf die glitschigen Stämme zu hieven. Nachdem sich das Dickicht im Innern des Waldes etwas gelichtet hatte, konnten wir uns wieder aufrecht bewegen. Nach wie vor führte das Gelände schroff aufwärts. Wie lange noch würde unser Martyrium andauern? Konrad half mir über Baumleichen, lotste mich an morschen Strünken vorbei. Wir handelten nur noch mechanisch, jeder Schritt zehrte an letzten Kraftreserven. Unter keinen Umständen durfte unsere Konzentration nachlassen, denn jede kleine Nachlässigkeit, jede falsche Bewegung würde unser Schicksal besiegeln. Doch das Schicksal hatte ein Einsehen mit uns. Eine dominante Steilwand kam uns bekannt vor, und nachdem wir einige Meter ihren Fuss entlanggegangen waren, realisierten wir beide gleichzeitig, wo wir uns befanden. Es handelte sich um jene Felsplattform, von der aus wir unseren Abstieg begonnen hatten. Wir waren im Kreis gelaufen! Die letzten Meter überbrückten wir auf Windesflügeln, und oben angelangt war ich versucht, den Boden unter meinen Füssen zu küssen. Unser Herzschlag war noch immer beschleunigt, als wir uns auf eine Sitzbank mit Sicht über Hauenstein setzten. Still sahen wir zu, wie die Konturen der Belchenflue sich im Zwielicht der hereinbrechenden Nacht langsam verwischten. Ein Gefühl tiefen Friedens erfüllte uns. Wir waren am Leben.
- 39. Hummel und Spinat Margarete Hummel war 80 Jahre, einen Monat, zwei Wochen, dreizehn Stunden und 34 Minuten alt, als sie plötzlich ernsthaft begann ihr Leben zu hinterfragen. Sie sass im Speisesaal des Seniorenwohnheims Sonnenschein, in demselben, mit senfgelbem Stoff überzogenen Sessel, in dem sie immer sass und starrte auf die schwarze Tafel, auf die mit weisser Kreide in übertrieben optimistisch geschwungenen Buchstaben das Tagesmenü angepriesen wurde. Spinat stand da. Eigentlich noch eine ganze Menge sonst, doch ihre Augen klebten nur an diesem einen Wort fest. Spinat, 6 Buchstaben, ein ganz normales Wort, Spinat. Aber Heute schien es ihr, als hätte sie gerade ein Jahrhunderte altes Geheimnis gelöst. Als wäre sie gerade hinter den tieferen Sinn des Wortes Spinat gekommen. Eigentlich stand dort Rahmspinat, aber Rahm hatte sie noch nie interessiert, sie war sowieso Laktose intolerant. Obwohl sie sich anfangs strikt geweigert hatte bei diesen Allergie- und Unverträglichkeitstrends mitzumachen. Und genau an diesem Tag, diesem Freitag im Juni entlarvte Margarete dieses unscheinbar wirkende Gericht als das was es wirklich war. Geschmackloser, von Kindern auf der ganzen Welt leidenschaftlich gehasster, grüner Matsch mit der Konsistenz von verdautem Salat. Margarete Hummel hatte genau zwei Möglichkeiten. Sie konnte sich dem labbrigen Blattgemüse stellen oder fliehen. Sie entschied sich für Letzteres. Langsam erhob sie sich aus dem Sessel, schlenderte so unauffällig wie es eben ging wenn man auf einen Stock als Gehilfe angewiesen war, durch den Flur und verschwand durch die Tür. Margarete wusste, dass ca. 100 Meter vom Wohnheim entfernt eine Bushalltestelle stand. Das war ihr Ziel und der zweite Teil ihrer Flucht. Ihre Beine waren zwar langsam, dennoch erreichte sie die Bushalltestelle, welche aus nichts weiterem bestand als einer grün gestrichenen Bank und einem Abfalleimer, aus dem eine an gematschte Bananenschale hing. Die grüne Sitzgelegenheit war nicht ganz leer. Eine junge Frau sass darauf. Sie hatte langes, braunes Haar, trug Jeans, einen grauen Pullover und machte allgemein den Eindruck als versuchte sie mit der Bank unter ihr zu verschmelzen um, wenn irgendwie möglich, den Gipfel der Unauffälligkeit zu erreichen. Ihre Knie hielt sie fest zusammengedrückt, wodurch sie so verkniffen wirkte wie Margarete selbst wenn diese früher in der Kirche gesessen hatte, peinlich genau darauf bedacht mit Hilfe ihres Rocks jedes noch so kleine Stück Haut zu bedecken. Als Margarete sich neben die Frau setzte, hob diese den Kopf und lächelte rasch. Margaretes Erziehung verlangte eine Erwiderung. Sie lächelte zurück. Die junge Frau zog ein Mobiltelefon aus ihrer Hosentasche und sah auf den Display. Dann steckte
- 40. sie es weg, zog es wieder hervor und blickte erneut darauf, so als erwartete sie, dass sich während der letzten zehn Sekunden jemand bei ihr gemeldet hätte. Schliesslich begann sie das Telefon ohne Unterbruch in den Händen hin und her zu drehen. Margarete versuchte das Schauspiel zu ignorieren. Sie hatte nie ein Mobiltelefon besessen. Wozu auch? Es gab eigentlich niemanden den sie anrufen wollte. Genau so wenig gab es jemanden der sie anrief. Ihr reichte es völlig aus, zu wissen, dass im Flur des Seniorenwohnheims, direkt neben den Besuchertoiletten ein Telefon an der Wand hing. Die junge Frau unterbrach ihren Jonglage Akt um zu seufzen und dann weiter zu mache wie bisher. Margarete konnte sich nicht länger zurück hallten. Diese junge Frau und ihr Mobiltelefon versauten ihr ihre Flucht. Das konnte sie nicht einfach so hinnehmen. „Kindchen, bitte seien Sie so gut und stecken Sie das Ding wieder weg. Das machst mich ganz nervös.“ Eines der wenigen Vorteile die man genoss wenn man 80 war, man durfte so gut wie jeden anderen Menschen Kindchen nenne, weil praktisch alle jünger waren als man selbst. Der zweite Vorteil, niemand konnte einer alten Dame böse sein. Die junge Frau lächelte wieder, dieses Mal etwas verlegener. „Ja natürlich, bitte entschuldigen Sie das war unhöflich.“ Sie steckte das Telefon wieder in die Hosentasche und begann stattdessen ihre Finger zu kneten. „Was macht Ihnen solche Sorgen?“, fragte Margarete freundlich. „Es geht um meinem Freund, wir sind seit fast zwei Jahren zusammen.“ Margarete lächelte aufmunternd wie man einem Kind zulächelt das gerade zum ersten Mal das Töpfchen Thema in Angriff nimmt. „Das ist ja schön, zwei Jahre.“ Die Frau nickte. „Ja, sehr schön. Aber letzte Woche hat er mich gefragt ob ich mit ihm zusammen ziehen will. Und ich bin mir nicht sicher. Ich weiss es einfach nicht.“ „Warum?“, fragte Margarete. Weit und breit noch kein Bus. „Ich weiss es nicht“, antwortete die Frau die ihre Finger hektischer knetete als je zuvor. „Lieben Sie ihn denn nicht?“ Normalerweise war Margarete nicht so forsch. Das war nicht ihr Stil. Doch jetzt befand sie sich auf der Flucht, keine Zeit für umständliche Formulierungen. „Doch, doch ich liebe ihn sehr. Ich bin mir nur nicht sicher ob es gut ist, wissen sie. Vielleicht ist es ein Fehler, vielleicht sogar der grösste Fehler meines Lebens. Was wenn wir plötzlich nur noch streiten. Können Sie das verstehen?“ „Eigentlich nicht. Ich habe zwei Ehemänner überlebt, streiten war bei beiden meine zweit liebste Beschäftigung.“ Die junge Frau nickte betrübt. „Ich weiss oft nicht genau was ich will, das ist ein grosses Problem. Nicht nur wegen meinem Freund, auch wegen anderen Sachen. Meinen Job zum Beispiel. Ich arbeite in einem Kaufhaus und verkaufe Grusskarten, doch eigentlich möchte ich viel lieber etwas anderes machen.“ „Warum tun Sie es dann nicht?“ Immer noch kein Bus. „Ich weiss es nicht genau. Ich denke ich habe einfach zu grosse
- 41. Angst. Wenn ich meinen Job aufgebe und etwas anderes mache und das dann nicht klappt, dann habe ich gar nichts mehr.“ Margarete nickte mit dem Kopf weil sie nicht wusste was sie sonst tun sollte. „Und ich will ein Tattoo. Irgendetwas Kleines, unauffälliges das nicht jeder sehen kann, vielleicht auf dem Rücken. Aber ich habe Angst. Was wenn ich älter werde und es mir dann nicht mehr gefällt? Das geht ja nie wieder weg.“ Margarete holte tief Luft. Dass der Bus sie so lange warten liess machte sie langsam ein wenig wütend. „Also wenn ich das richtig verstanden habe Kindchen, dann wissen Sie nicht ob sie mit dem Mann zusammen leben wollen den Sie lieben, den Job kündigen sollten den Sie hassen und den Körper verunstalten sollen der Ihnen gehört.“ Die junge Frau nickte wieder. „Ich habe einfach solche Angst, vor so vielen Sachen. Ich bin mir nie ganz sicher ob das was ich tue richtig ist.“ Margarete schüttelte den Kopf. „Wie alt sind Sie Kindchen?“ „Ich bin 25 Jahre alt.“ Margarete schlug sich beherzt auf eines ihrer Beine, welche in hautfarbenen Strümpfen steckten. Es klatschte. „Jetzt hören Sie mal zu Kindchen. Sie sind 25 Jahre alt und vermitteln den Eindruck, dass sie am liebsten unsichtbar wären. Sie sind leise und ängstlich obwohl sie laut sein sollten und voller Leben. Auffällig und voller Tatendrang jeden Tag neue Fehler zu machen. Wenn Sie den Mann lieben, dann ziehen sie mit ihm zusammen weil sie sonst nie herausfinden ob er zu Ihnen passt. Wenn Sie ihren Job nicht mögen, dann kündigen Sie und machen Sie etwas anderes. Und wegen dem Gekritzel auf Ihrer Haut, Falten sehen doch alle gleich aus. Sie können warten wenn Sie wollen, weil sie Angst haben das ihnen ihr Tattoo später nicht mehr gefällt. Und irgendwann ist dann später und dann ist es zu spät.“ Die junge Frau hörte aufmerksam zu. Es war das erste Mal dass sie Margarete in die Augen sah. „Ich denke Sie haben Recht.“ „Und ob ich Recht habe Kindchen.“ Margarete sah aus den Augenwinkeln wie ein Pfleger ganz in weiss gekleidet auf die Strasse trat und hektisch in beide Richtungen der Strasse sah. „Sie müssen nicht auf mich hören wenn Sie nicht wollen, aber glauben Sie mir, irgendwann sind Sie nicht mehr 25, dann kommt vielleicht der Tag am dem Sie 80 Jahre, einen Monat, zwei Wochen, dreizehn Stunden und 34 Minuten alt sind und sich wünschen Sie hätten all die Dinge getan vor denen Sie sich immer gefürchtet haben. Irgendwann wenn Sie alt sind und Sie sich nur noch über Spinat aufregen können und Sie feststellen müssen, dass Sie plötzlich keine Angst mehr haben weil es nichts mehr gibt wovor es sich lohnen würde Angst zu haben.“ Die Frau nickte wieder. „Und dann erkennen Sie dass es immer nur Ihre Angst war die Ihnen im Weg stand und dass sich dahinter in Wirklichkeit gar nichts verbirgt. Und sie werden schrecklich traurig sein Kindchen, traurig und einsam weil Sie nie den Mut hatten etwas zu riskieren.“ Der Pfleger trat
- 42. neben Margarete und sah sie freundlich an. „Guten Tag Frau Hummel. Ich habe Sie schon überall gesucht. Wollen wir nicht rein gehen. Es ist schon fast Zeit fürs Mittagessen.“ Margarete Hummel nickte, erhob sich langsam, straffte die Schultern und folgte dem Pfleger langsam zurück zum Seniorenwohnheim. Als sie sich umdrehte sah sie gerade noch wie die junge Frau in den Bus ein stieg der gerade vor der Bushalltestelle gehalten hatte. „Wo wollten Sie denn Heute hin Frau Hummel? So kurz vor dem Mittagessen. Heute gibt es doch Spinat.“
- 43. Übrigens..... „Lass dich nicht anquatschen...!“ Kürzlich befand sich Susanne Meyer auf dem Heimflug Hamburg ins Niederamt. Sie ist ein wenig verrückt, anfangs Fünfzig, brünett, in blauen Jeans und schwarzem Pulli, dicker Jacke und Schal. Schwer bepackt mit Koffer und einem Korb voller Hamburger-Tassen und sonstigen Spezialitäten ist sie unterwegs mit der U-Bahn S1 zum Flughafen. Susanne hatte ihre Freunde in der Hansestadt besucht und befand sich nun auf dem Heimweg in die Schweiz. Noch klangen ihr die Worte ihres Freundes Albrecht im Ohr: „... und lass dich nicht anquatschen und quatsch nicht alle an...!“ Susanne besitzt das Flair sehr schnell mit Menschen in Kontakt zu kommen. Bei ihren Urlaubsreisen steigt sie in ein Flugzeug, checkt in ihrem Hotel ein und kennt bereits die Lebensgeschichten der anderen Feriengäste. Mit einem Lächeln im Gesicht und ihrer Hilfsbereitschaft passieren ihr die abstrusesten Sachen, so eben auch im hanseatischen Flughafen Fuhlsbüttel. Zwei Hanseaten reisen ins Gäu Gemütlich genehmigte sich Susanne in der Abflughalle an der Theke beim Gate 29 eine heisse Tasse Kaffee und eine letzte Zigarette. Nicht die allerletzte Zigarette, sondern die letzte Zigarette vor dem Abflug. Gedankenversunken sass sie da und liess die schönen Erlebnisse der vergangenen Tage noch mal Revue passieren, als zwei Herren sich an der gleichen Stehbar mit O-Saft und Kaffee dazu gesellten. Beide korrekt angezogen mit Anzug, Hemd und Kravatte, Schal und Mantel. Die Schlussfolgerung von Susanne: „dies sind Geschäftsherren“. Der jüngere hörte auf den Namen Torsten von Bergedorf und der ältere auf den Namen Peter Wagner. Torsten erzählte seinem Chef – wie sich später herausstellte - ein unglaublich lustiges Erlebnis aus London. Das war so witzig und bunt erzählt, dass Susanne mitlachen musste und sich eine ihrer berühmt berüchtigten Bemerkungen einfach nicht verkneifen konnte. Wie es so ist, kamen die drei ins Gespräch: „Wohin fliegen Sie?“ „Geschäftlich oder privat?“ Dabei es stellte sich heraus, dass der Geschäftstermin der beiden Herren genau in die Gegend von Susanne Meyer führte, nämlich ins Gäu, nach Neuendorf. Wer sich in der Schweizer Geografie auskennt, der weiss, dass das Gäu ein Bezirk im Kanton Solothurn ist und Neuendorf ein kleines Dorf. „Zwei Hanseaten reisen ins Gäu“, schmunzelte Susanne vor sich hin, denn sie würde nicht freiwillig ins Gäu ziehen, nur so nebenbei bemerkt. „Vom Tor zur Welt ab ins Kaff“. Susanne ist bei ihren Freunden als sehr spontan bekannt und so machte sie Peter Wagner und Torsten von Bergedorf das Angebot vom Basler Flughafen Mulhouse nach Olten in ihrem Wagen mit zu fahren: „Am Bahnhof setze ich euch ab. Es fahren regelmässig Busse oder Taxis nach Neuendorf.“ „Abgemacht! Das ist doch ein toller Vorschlag“, antworteten die beiden Herren der Schöpfung begeistert.
- 44. Der Flug Hamburg-Basel hob mit einer halbstündigen Verspätung ab und landete dementsprechend auch um eine halbe Stunde später. Ein Smal-Talk über den Wolken verkürzte die Zeit der drei Reisenden. Nach der Landung bei der Gepäckabgabe bekam Susanne Meyer ihren ersten Schreck: „Uppps, wie bekomme ich Wagner und von Bergedorf plus drei Koffer plus meine vollgestopfte Reisetasche und den Korb in meinen Wagen?“ Sie blieb jedoch ganz cool, liess sich nichts anmerken. „Versprochen ist versprochen und das kriegen wir schon hin“, dachte sie. Wenn das Möckli streikt Es ist noch zu sagen, dass Susanne Meyer erst seit etwa acht Wochen wieder einen Wagen besitzt. Er ist ihr ganzer Stolz, denn für 1500 Franken ein Auto, erst noch von der Motorfahrzeugkontrolle geprüft, das ist eine Glanzleistung und ein Schnäppchen besonderer Art. Andere bezahlen viel mehr und haben erst noch kein Schiebedach. Meyers Auto hat nämlich ein Schiebdach. Aber das ist eine Geschichte für sich. Das weisse Auto von Susanne Meyer nicht allzu gross ist – ein Mazda 121. Es sieht aus wie ein Ei und hat den Beinamen „Möckli“. Wohlbehütet stand der Wagen seit fünf Tagen auf Parkplatz S3, Reihe D, hinten, ganz rechts aussen. Immer noch damit beschäftigt, wie alles wohl in das Auto reinpasst, wurde der Kofferraum geöffnet und Torsten von Bergedorf bot sich als Kavalier an und hievte ein Objekt nach dem andern in den Stauraum. Nur der Rollkoffer von Susanne musste auf der hinteren Sitzbank verstaut werden. Der geflochtene Korb mit den Tassen fand auf den Knien des Co-Piloten seinen Platz. Also Peter Wagner vorne als Beifahrer, Torsten von Bergedorf liess sich in den Fond fallen. Susanne Meyer als Chauffeuse drehte den Schlüssel. Krrrrr – krrrrr – krrrr! Der Motor knirschte und stotterte vor sich hin und kam nicht auf Touren. Wieder krrrr – krrrr! Susanne Meyer wäre am liebsten zur Briefmarken geworden, hätte sich auf einen Luftpostbrief nach Australien kleben, abstempeln und losschicken lassen – möglichst noch als Express. Peinlich, peinlich. Susanne wurde nicht zur Briefmarke, sie blieb in voller Grösse im Auto sitzen und pumpte mit dem Gaspedal, drückte die Kupplung beinahe durch den Boden. Nichts, aber auch wirklich nichts ging. Kurzer Hand bot sie schwach lächelnd Peter Wagner den Autoschlüssel an: „versuchen Sie es bitte.“ Auch Wagner gelang es auch nicht, den Madza zum Laufen zu bringen. Susanne schlug den Herren vor, sie sollen wieder zurück zum Flughafen, um sich dort einen Kaffee zu genehmigen oder sich gar mit dem nächsten Bus zum Bahnhof aus den Staub zu machen. Doch Thorsten von Bergedorf lachte: „wir sind die drei Musketiere und wir bleiben zusammen.“ Susanne dachte, „der will doch nur sehen, wie ich zu Grunde geh vor lauter Peinlichkeit.“
